Ich gestehe, dass ich des Titels des Buches von Sabine M. Gruber wegen Probleme hatte, es vorurteilsfrei aufzuschlagen. Das Buch heißt »Beziehungsreise« und es geht um das Wort »Beziehung« darin. In einer Zeit, in der 12jährige in Facebook bekennen »in einer Beziehung« zu sein, fällt es mir schwer, dieses Wort Ernst zu nehmen, so ausgehöhlt erscheint es mir inzwischen. Und hier interagieren erwachsene Menschen; Sophia ist am Ende 44, Marcus 51. Aber auf eine besonders perfide Art charakterisiert das technokratische Wort »Beziehung« diese Bindung kongenialer als das schöne, altertümliche »Liebschaft«, die aristokratische Bezeichnung »Liaison« oder das verrucht konnotierte Wort von der »Affäre«.
Unveränderte Lage des Testzettels
Sophia hatte sich im Laufe der Jahre mit einer »Ghostwriter«-Agentur selbständig gemacht. Das Geschäft läuft mehr schlecht als recht. Ihre Pläne als Schriftstellerin zu reüssieren, hat sie ad acta gelegt. Dr. Marcus Hahse arbeitet in einer Bibliothek und schreibt gelegentlich Rezensionen – zunächst für die Bibliothekszeitung, später für eine nicht näher genannte »große« Zeitung. Marcus hatte als Juror eine Kurzgeschichte Sophias bei einem Literaturwettbewerb für einen Preis vorgeschlagen und diese Geschichte dann anschließend in einem Sammelband in einem einzigen Satz (sic!) lobend erwähnt. Es kam zu einem ersten Rendezvous. Schließlich übergab sie Marcus ein Romanmanuskript. Sie sollte sehr lange nichts mehr von diesem Manuskript hören. Als sie es nach letzten Reise, nach fast zehn Jahren, zurückfordert, befindet sich »der kleine gelbe Testzettel« zwischen Blatt 83 und 84 immer noch darin. Es gehört zu einer der fast unzählbaren Demütigungen in diesen Jahren das Marcus diesen Text nicht gelesen hat. Schon einmal, als sie ihm einen literarischen Essay übergibt und um seine Meinung zu den Thesen ersucht, echauffiert er sich über orthografische Fehler. Er habe fünf Stunden seiner Freizeit für die Lektüre »geopfert«, so Marcus zur konsternierten Sophia.
Aber Marcus, der gerne »Top-Rezensent« im Feuilleton werden möchte, liest »eigentlich nichts«. Die Fahnen seiner Rezensionsexemplare blättert er nur durch und macht sich Notizen in krakeliger Handschrift auf DIN-A‑5 Zetteln. Einige der Bücher werden genannt, wie »Alice« (Judith Herrmann), »Ruhm« (Daniel Kehlmann), »Feuchtgebiete« (Charlotte Roche), »Der Winter im Süden« (Norbert Gstrein) oder »Kingpeng« (Linda Swift). Er nimmt diese Texte in den Urlaub, um sie nicht zu lesen. Sophia darf sie in keinem Fall anrühren; ihr Urteil gilt ihm nichts. Er echauffiert sich lautstark, wenn sie ein begründetes Urteil über einen Autor abgibt. Er hält dagegen, obwohl er nur rudimentäre Kenntnisse besitzt. Seine Besprechungen soll Sophia in der Zeitung lesen; es gibt keinen Austausch über seine Arbeit. (Auch der Leser wird nichts über Marcus’ Urteile lesen können – ein absichtsvoller Zug der Autorin, den ich sehr bedauere.) Es besteht kein Zweifel, dass Dr. Marcus Hahse in diesem Buch für den geist- wie empathielosen Mainstream-Kulturapparat steht. Als er »Feuchtgebiete« durchblättert (und längst seine positive Meinung formuliert hat), liest sie »Die morawische Nacht« von Peter Handke. Gnadenhalber liest er auch ein paar Seiten in dem Buch, was Sophia schon als Erfolg für sich verbucht. Wie groß die Differenz des literarischen Anspruchs bei den beiden ist, zeigt sich noch in einer anderen Szene: Als Marcus »Engel der Sinnlichkeit« »liest« (immerhin parallel mit »Berlin Alexanderplatz«; einer Lektüre, von der er, wie es mokant heißt, noch lange »zehren« wird) beschäftigt sich Sophia mit »Der Lebenslauf der Liebe«. Die Vergewaltigung hatte Sophia auch (hoffentlich nur vorübergehend) intellektuell beschädigt: Unvorstellbar, dass sie, die Handke- und Walser-Leserin, unter normalen Umständen den »Förster vom Silbersee«, ein Titel, der im Hotelzimmer verfügbar ist, als Lesestoff genommen hätte.
Es ist schon auf eine fast perverse Art und Weise reizvoll, den Verfall dieses Verhältnisses von hinten nach vorne zu beobachten. Bis auf eine Ausnahme bestehen die Kapitel aus Urlaubserzählungen, die auktorial, aber aus der Sicht von Sophia erzählt werden. Zum Teil werden zukünftige Entwicklungen vorweggenommen, die auch nicht immer in den vorher gelesenen, entsprechenden Kapiteln vorkommen. Insgesamt kontrastieren die zuweilen euphorisch erzählten Reiseeindrücke (man achtet sehr auf ein kulturelles Programm jenseits des bloßen »Tourismus« und das auch, wenn eine Wellnessoase aufgesucht wird) mit der Aufmerksamkeit Sophias für Marcus’ Launen, die oft urplötzlich und unmotiviert wechseln.
Es entsteht mit der Zeit eine Art virtueller Demütigungsraum, der alle Aspekte eines Zusammenlebens umfasst: Sophia plant und organisiert nicht nur die Urlaube, sondern bezahlt sie zumeist und sogar jene, die zu ihrem Geburtstag stattfinden. Da Marcus ihren Geburtstag zumeist vergisst bzw. ihre Wünsche einfach ignoriert, kauft sie sich irgendwann sogar ihr Geburtstagsgeschenk selber. Sophias Geschenke behandelt Marcus lieblos; manche tauscht er kommentarlos gegen Gaben anderer Freunde einfach aus. Das größte Lob aus seinem Mund ist ein joviales »gut gemacht«, wenn etwas »funktioniert« hat (ein besonders schönes Zimmer, eine herrliche Aussicht auf einem Ausflug).
Kammerspiel und blutige Daumen
Obwohl die beiden durch halb Europa reisen (der zweite Teil des Buchtitels!), hat man das Gefühl eines Kammerspiels. Dabei kommt Marcus bedingt durch die Erzählkonstruktion ein bisschen zu kurz; die Rolle als Arschloch ist sehr deutlich festgeschrieben. Es gibt nur ein ständig wiederkehrendes Symptom, dass die seine Gemütslage und innere Verunsicherung zeigt: die fast permanent mit den Zeigefingern abgeknibbelten, blutigen Daumen, die er im täglichen Umgang geschickt zu verbergen weiß. Das sei genetisch bedingt, behauptet er. Nur sehr am Rande wird die zeitweilig fragile Arbeitssituation Marcus’ in der Bibliothek erwähnt, sein Problem mit einem Vorgesetzten. Vermutlich möchte er dieser Welt entfliehen – um dann einer dieser Rezensionsäffchen zu werden, die den vermeintlichen Chefs nach dem Mund reden bzw. schreiben müssen (» ‘Glaubst du, ich lege mich mit denen da oben an?’ «, fragt er einmal in einer Mischung aus Empörung und Ratlosigkeit).
Wie eine besondere Art von Angebot werden manchmal lexikalische Definitionen diverser psycho-pathologischer Krankheitsbilder zitiert (bspw. Double-Bind und Borderline), die in irgendeiner Form auf Marcus zutreffen bzw. dessen Verhalten erklären könnten. Diese kontrastieren mit kleinen Zitaten aus touristischen Werbebroschüren über das jeweils ausgesuchte Hotel. Eine wichtige Rolle spielt auch das Fotografieren und das Fotografiert-Werden in diesem Roman – nebst dem Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie. Es sind diese kleinen, feinen Zeichen, die Gruber einfließen lässt, und die man fast überliest.
»Mehrliebig«
Nach einem Drittel des Buches erfährt man, wer der eingangs erwähnte Georg ist: Sophias Mann. Sie hatten jung geheiratet, sich »einander Treue geschworen«, ihre Ehe aber »mehrliebig« angelegt, ohne »immerwährende Ausschließlichkeit« auf einen Partner. Wenn sie mit Marcus in Urlaub fährt, unternimmt Georg mit Stephan, ihrem Sohn, auch etwas, wie zum Beispiel Snowboarden. Sophia berichtet ihrem Mann sogar von den Problemen mit Marcus. Sein Spitzname für den Geliebten seiner Frau ist so treffend wie nüchtern: »Der Patient«.
Bevor er Sophia kennenlernte habe er, so Marcus’ Aussage, acht Jahre keine Frau gekannt. Und so »organisiert« Sophia die »Beziehung« auch auf sexuellem Gebiet. Der ansonsten angenehm keusche Roman deutet nur wenige Male Marcus’ Potenzprobleme und Sophias Geduld an (einmal in einer Therapiesitzung). Auch hier zeigt sich die Aufopferungsrolle, in der Sophia fast wollüstig zu schlüpfen scheint. Die Vergewaltigung nach zehn Jahren ist daher durchaus von einer gewissen Tragik. Ansonsten wird der Sex zwischen den beiden ein Spiegel ihres sonstigen Zusammenseins sein. Er wird sie anfangs (und am Ende) wie eine Hure behandeln. Wenn überhaupt, ist der Sex mit ihm später zumeist »ohne Intimität« und »unzärtlich«.
Wird anfangs noch von den euphorischen Momenten des »Hierseins« in besonders schönen, »heilenden« Orten (beispielsweise in Myra oder auf Island) geschwärmt und geschwelgt, so konzentriert es sich immer mehr auf Marcus’ Wohlbefinden. Zwar wird Sophia mehrfach ihrem Ärger Luft machen, Briefe und Mails schreiben voller »Zorn der Verzweiflung«, Wut und Flehen. Reaktionen gibt es kaum; Entschuldigungen von Marcus’ Seite keine. Wie Sophia in ihrem Beruf als unbekannte Textschreiberin verschwindet (und auch durch einen drohenden Rechtsstreit mit einer namensähnlichen Schriftstellerin am Ende die Schriftstellerei resigniert abbricht*), so scheint sie auch im Zusammenleben mit Marcus als Persönlichkeit verschwinden zu müssen, um zu gefallen. Sophia verbiegt sich immer mehr, um eine auch nur sehr kleine Zeitspanne einer Harmonie zu erreichen. Sie fügt sich bereitwillig Marcus’ Zeitdiktat, welches nur eine Zeit von 9 Uhr bis 9.08 Uhr ergibt, um ihn auf dem Handy anzurufen, zu »stören«; ansonsten ist nur die »Sprachbox« an. Rückrufe gibt es nicht. »Aggressives Schweigen«. Die Termine mit seiner Familie (seiner Mutter, der Ex-Frau und Tochter) schirmt er sorgsam ab. Trifft sich Sophia mit ihrer Familie, wird er wütend, er will nicht der »Pausenkasperl« sein, will sie immer und zu jeder Gelegenheit beanspruchen können – um dann davon kaum Gebrauch zu machen.
Samstags Abends trifft man sich, aber Sophia bleibt nicht bis zum Sonntagmorgen: Marcus ist es zu aufwendig, das Frühstück für zwei zu organisieren; er will sich nicht »in der Früh« um sie »kümmern«. Oder wenn er einmal der noch kranken Sophia sagt, er wäre auch ohne sie in den Urlaub geflogen, wenn sie nicht hätte mitfliegen können. Es sind diese lieblos dahergesagten Nebensätze, die Wunden schlagen. Nach einem Streit, in dem sie sich wieder Luft verschafft hatte, verlässt sie Marcus. »Am nächsten Tag entschuldigt sie sich, und Marcus verzeiht ihr« heißt es dann ironisch-lakonisch.
Eine Frage der Möglichkeit
Sophia sucht sogar einen systemischen Therapeuten auf, der ihr zuhört, aber nach Ablauf der Stunde auch das nicht mehr (Woody Allen lässt grüßen). Sie wird irgendwann feststellen, dass diese Therapie (50 Minuten für 70 Euro, alle 14 Tage) »ihre Beziehung…künstlich beatmet und künstlich ernährt« hat. Und dann sind es zwei Ereignisse, die sie trotzdem immer wieder eine Form der (trügerischen) Sicherheit bei Marcus suchen lassen: Zum einen eine Schwangerschaft im ersten Jahr ihres Zusammenseins. Sie wird das Kind unter großen Qualen abtreiben; Marcus wird diese Sache nie mehr erwähnen. Aber von nun an, so die Erzählerin wie sonst selten emphatisch, steht dieses ungeborene Kind wie ein richtiges in diesem Verhältnis. Das zweite, Sophia bis ins Mark erschütternde Ereignis, ist der Freitod ihres älteren, am Ende depressiven Bruders. Das Kapitel hierzu (eine Erzählung aus Sabine M. Grubers Geschichtenband »Kurzparkzone« von 2010) ist das einzige, was nicht mit Sophia und Marcus und den Reisen zu tun hat. Sie wird den Tod ihres Bruders mit ihrer Mutter durchleben und durchleiden und es wird sie immer wieder einholen, besonders auf der Reise in die Türkei, nicht zuletzt weil ihr Bruder sich dort heimisch fühlte und sogar die Sprache gelernt hatte.
Die Glücksversprechen und harmonischen Lebensentwürfe, der Sophia fast verzweifelt nacheifert, scheitern fast ausnahmslos bzw. erhalten keine Dauer. Erzählt wird dies ohne falsches Pathos und ohne die Figur einem billigen Voyeurismus auszuliefern. Manchmal fühlt man sich an Marlene Streeruwitz’ Frauenfiguren erinnert, etwa an Helene aus »Verführungen«. Im Gegensatz zu Helene ist Sophia zwar die aktiv-handelnde Person, auch in sexueller Hinsicht und die Emanzipation scheinbar vollzogen – die Frau ist nicht mehr nur die Betrogene, sondern die »Mehrliebige«. Aber da helfen auch die extravaganten, gegen Ende fast luxuriösen Urlaubsorte und das gediegene kulturelle Programm nebst genauer Vorbereitung nicht: Es klappt nicht. Dennoch taugt Sophia bei aller Härte der ihr zugefügten Herabsetzungen nicht als Prototyp des »armen Hascherls«. Die allzu geläufige, bequeme Rubrizierung in »Opfer« und »Täter« verfängt nicht – es gab jederzeit die Möglichkeit, die Beziehung zu beenden. Und einmal heißt es ja, sie hätten sich schon 20 oder 25mal getrennt. Sophia macht weiter, weil sie bis zum Schluss (der im Roman der Beginn ist) an die Möglichkeit des guten Lebens glaubt. In einer ihrer Therapiesitzungen stellt sie sich selber die Frage: »Verliebt man sich nicht immer in die Möglichkeiten eines Menschen, in das, was er sein könnte?« Mit der Grenzüberschreitung von der seelischen zur physischen Gewalt ist diese Möglichkeitsphilosophie eigentlich vorbei. Trotz eindeutiger Zeichen bleibt dennoch unklar, ob Sophia die Trennung von Marcus gelingen wird.
Sabine M. Gruber vermeidet klugerweise jede direkte moralische Wertung der Ereignisse. Und wer fertiggekautes genderspezifisches Jargon sozusagen als Draufgabe mitgeliefert erwartet, wird vergeblich suchen. Der Leser, die Leserin, muss da selber durch. Die Sprache ist angenehm unprätentiös, was zunächst dazu verleitet, die Doppelbödigkeit, die in diesem Buch steckt, zu unterschätzen. Allerdings gibt es geschickt platzierte Auflockerungen in Form eines leicht ironischen Untertons, der gelegentlich ins Kalauerhafte changiert, ohne dabei abzustürzen (und ohne epigonal zur größten österreichischen Kalauerdichterin Elfriede Jelinek zu wirken). Der Sog, der trotz des vermeintlich bekannten Endes entsteht, wurde bereits angesprochen. Und das Kapitel zu Beginn liest man dann nach der Lektüre des ganzen Buches noch einmal.
- – -
* Ob Sabine M. Gruber hier auf die Verwechslungen mit der österreichisch-italienischen Schriftstellerin Sabine Gruber (zuletzt: »Stillbach oder Die Sehnsucht«) anspielt?
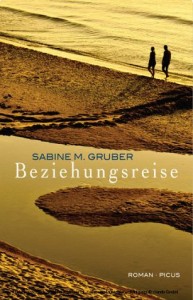
einerseits bin ich jetzt wirklich neugierig auf den Buchinhalt, aber andererseits muss ich leider gestehen, dass der Artikel sehr verwirrend geschrieben ist, sprich extrem viel Information in wenig Sätzen. Und trotzdem obwohl ich nun leicht verwirrt und erschlagen bin, von der flut der Informationen, bin ich dennoch gewillt, mir dieses Buch mal zu Gemüte zu führen. Interessante Art jmd. für etwas zu gewinnen.