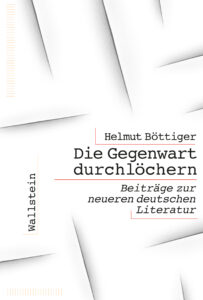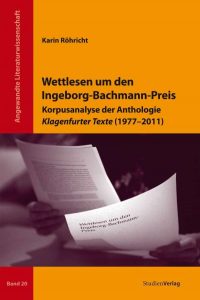Der Kärntner Janko Ferk ist ein Tausendsassa: Richter (im Ruhestand), Literaturwissenschaftler mit Schwerpunkt Franz Kafka, Übersetzer, Initiator eines Lexikons Kärntner slowenischer Literatur, Autor von Sachbüchern Reiseführern, Novellen, Romanen, Essays und Literaturkritiken. Letztere werden in unregelmässigen Abständen in einer Art Sammelband im LIT-Verlag zusammengefasst. Durch den Titel Mit dem Bleistift in der Hand (ein Handke-Zitat) wurde ich auf den dritten, aktuellen Band seiner Rezensionssammlung aufmerksam, der insgesamt 33 Kritiken von 2018 bis 2021 sowie zwei Originalbeiträge enthält.
Ferks Texte erscheinen hauptsächlich in österreichischen Medien, insbesondere sind hier die »Wiener Zeitung«, »Die Presse« und das »Literaturhaus« aus Wien zu nennen, wobei im Nachweis des Buchs leider der Webseiten-Umzug des Literaturhauses nicht berücksichtigt wurde. Die Kritiken haben fast alle »zeitungsgerechtes« Kurzformat, selten sind es mehr als drei Seiten. Erstaunlicherweise findet sich trotzdem noch genügend Platz für die gendergemäße Doppelnennung; mein Favorit: »Nichtkärntnerinnen und Nichtkärntner.« Die Beschäftigung mit dem Rechtsanwalt, Schriftsteller und Dozenten Alfred Johannes Noll fällt ausführlicher aus, wobei es hier auch um fünf Werke geht, die Ferk hymnisch feiert (und zugibt, eines der Bücher nur quergelesen zu haben).
Fünf Texte beschäftigen sich direkt oder indirekt mit Franz Kafka, was nicht ganz verwundert, gilt doch Ferk als »Kafkologe« von Rang. Hier ist er in seinem Element, portraitiert griffig Maria-Luisa Caputo-Mayrs Verdienste um die Kafka-Forschung, spürt den Kafka-Schwestern nach, kritisiert die im Sammelband von Orthmann und Schuller »an den Haaren herbeigezogenen« Aufsätze und bemerkt süffisant, dass in Reiner Stachs Kafka von Tag zu Tag ein Hinweis auf die ähnlich gelagerte Chronik von Chris Bezzel aus dem Jahr 1975 fehlt. Zur juristischen Frage, wem denn nun Kafkas Nachlass gehöre, positioniert sich der Ferk eindeutig (was für einen Juristen bemerkenswert ist).