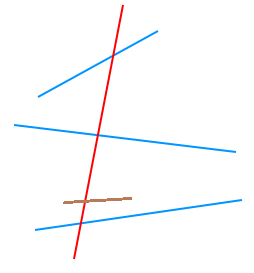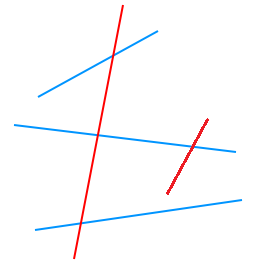Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Tschechows Gewehr. Wenn zu Beginn einer Erzählung ein Gewehr an der Wand hängt, muß es irgendwann losgehen, sei es auch erst auf der letzten Seite. Dieser Satz wird oft als Regel propagiert. Ökonomisches Erzählen, jahrzehntelang das literaturkritische Ideal und Heilmittel des deutschen Feuilletons. Bloß nichts Überflüssiges in die Geschichten!
Was, wenn das Gewehr nicht losgeht? In einem Film kann es mehr oder weniger zufällig an der Wand hängen, ein vergessenes Relikt, irgendwer hat es irgendwann dort aufgehängt. Doch der Schriftsteller muß es willentlich und eigenhändig beschreiben oder wenigstens evozieren, also gleichsam selbst aufhängen, sonst ist es nicht da. Der Schriftsteller wählt immer aus, selbst wenn er Realien in großer Fülle liebt, die Fülle der Nichtigkeiten. Er entscheidet – sicher oft unbewußt, aber in einem fort –, was zur Existenz kommt und was nicht. Dasselbe gilt für Maler, nicht aber für Photographen. Göttliche Dichter!
2002 sagte ein amerikanischer Filmkritiker im Gespräch mit Hayao Myazaki, dem Zeichner und Regisseur zahlreicher Zeichentrickfilme, er liebe die »gratuitous motion«, die unmotivierten Bewegungen – schwer zu übersetzen – in dessen Filmen. Grund- und zwecklose kleine Szenen, ohne Begründung oder notwendige Funktion im Erzählverlauf. Dinge, die sind, weil sie sind, und sich einfach nur ihrer Existenz erfreuen (oder zu ihr verdammt sind). Und den Betrachter erfreuen (oder beunruhigen), weil sie existieren. Hin und wieder sitzt eine Figur bloß da oder seufzt oder schaut auf einen dahinfließenden Fluß, oder tut zusätzlich irgendwas, das die Handlung nicht weiterbringt, »einfach nur, um ein Gefühl für die vergehende Zeit und für den Ort, an dem sie gerade sind, zu vermitteln.« Adalbert Stifter hat das auch gemacht, fast ein bißchen exzessiv in seinem letzten großen Werk, dem Witiko. Erzählen – und Lesen, vielleicht sogar noch mehr als Erzählen – heißt auch, sich in Geduld zu üben. Eine wichtige Übung, auf die wir nicht verzichten sollten. Ja, ja, liebe TikToker!