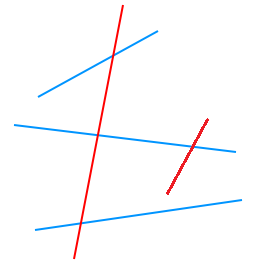Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Die kargen Romane Patrick Modianos, aber auch die opulenteren von Kazuo Ishiguro, unterscheiden sich wesentlich von denen der Generation Flauberts, aber auch von Joyce oder Döblin, indem sie stets einen Hof des Ungesagten um das Erzählte oder Angedeutete mitführen, d. h. »konstruieren« (das aber oft ganz unmerklich). »Much is left unsaid«. Ich weiß nicht, woher mir der der englische Satz zufliegt, denke aber nicht unbedingt an Hemingway und seine Spitze-des-Eisbergs-Theorie. Es ist ein starkes Bild, das der sichtbaren Spitzen, doch passender scheint mir das einer Aura, eines »halo« (wie die Franzosen sagen). Celans »Lichthof Bedeutung«, also wie in der Lyrik. Immer nur kleine Erhellungen, dazwischen Dunkelheit. Das alles nicht im altromantischen Sinn, sondern, wenn man so sagen kann, in erzähltechnisch Hinsicht. Wie funktioniert ein Roman? Indem mit Worten ein Raum ohne Worte geschaffen wird, gleichsam sein Unbewußtes, das der Autor weiß und uns aus strategischen Gründen nicht verrät. Wir, die Leser, können, wenn wir wollen, selber herumrätseln.
Weiß er es wirklich? Sind solche Autoren »allwissend«? Verschweigen sie etwas (vieles)? Für die Autoren, die ich hier im Auge habe, gilt das eher nicht. Sie arbeiten vielmehr mit ihrer Unwissenheit. Sie gehen aus vom Nichtverstehen, wollen den Bereich des Nichtverstehens womöglich reduzieren, wissen aber auch, daß das nie vollständig gelingen wird. Sie arbeiten mit Ahnungen. Vielleicht sind sie nicht einmal wissender als der Leser. Vielleicht ist manch ein Leser wissender als der Autor des Buchs, das er liest.
Kafka ist das Nonplusultra des erzählenden Schreibens im 20., vielleicht noch im 21. Jahrhundert. An diese These glauben viele, aber selten wird die Frage gestellt, was Kafka denn bewirkt hat, ob er Breschen geöffnet hat in der Literatur, oder besser: im Bereich literarischer, poetischer, imaginativer Sensibilität (an dem genauso der Leser teilhat). Eher wirkt Kafkas Werk monolithisch, seine ganze Schriftstellerexistenz ist ein besonderes, herausragendes, aber abgeschlossenes Kapitel. Bei Joyce ist das ganz anders, auf ihn kann man sich einlassen, mit seinem Werk mitgehen, wachsen, zum Fan werden, zum Spezialisten. In der New York Times stand unlängst ein Bericht über einen Lesekreis zum (prinzipiell unverständlichen) Finnegans Wake, der über Jahrzehnte ging und kürzlich zu einem glücklichen (?) Ende kam.
»End here. Us then. Finn, again! Take. Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. Lps. The keys to. Given! A way a lone a lost a last a loved a long the’.” So geht das Ende von Finnegans Wake: »End here«, ein reflexiver Satz, Selbstfeststellung oder – aufforderung. So gut wie jedes Wort, jede Wortfolge, jeder Ausdruck in diesem Roman hat mindestens zwei Bedeutungen, deutet mindestens zwei Sinnrichtungen an. Der »eigentliche« Sinn dieses Endes ist nicht schwer zu verstehen, es ist eine alltägliche Abschiedsszene. Wortakrobatisch verschlüsselt: Hier hast du die Schlüssel! Nach hundertjähriger, intensiver Rezeptionsgeschichte dieses Romans sind auch Lexika zur Entschlüsselung des Textes zustandegekommen. Das Wikipedia-Prinzip ist hier besonders sinnvoll: Jeder der vielen Amateur-Finneganians kann, soll und darf etwas beitragen. Das Wort, das ich in den Schlußsätzen gar nicht verstehe, ist »bussoftlhee«. Ich weiß natürlich, daß nicht nur die einzelnen Wörter mehrere Bedeutungen haben, sondern auch, daß Joyce sehr oft ein einzelnes Wort aus Teilen mehrerer Wörter zusammengekleistert hat. Die Wörter überlagern sich materiell, buchstäblich und phonetisch. In »bussoftlhee« steckt »buzz off!«, vielleicht zu übersetzen mit »geh schon!«, es steckt darin angeblich auch ein Shakespeare-Zitat (»but soft! what light through yonder…«), dann auch das ganz gewöhnliche »but softly«, d. h. der Abschied soll sanft oder leise sein, und dann noch »till he«, bis er – was? Das weiß ich nicht. »Lps« ist vielleicht »lips«, ein Kuß in der Abschiedsszene. Und so weiter. Stop. Mit so einem Text wird man natürlich nie fertig. Und wird doch fertig, aber erst nach langer Zeit. Ein hübsches Interpretationsspiel – auch eine Art von Unterhaltung.
Kafka hat keine Unterhaltungsliteratur geschrieben, er war weder Wortakrobat noch Geheimniskrämer. Es hat ernstgemacht, mit sich, mit der Umwelt – den spätentdeckten Kafkaschen Humor geschenkt. Er ging den Dingen, den Empfindungen auf den Grund, versuchte, die innere, traumartige Welt, die ihn beherrschte, oft auch quälte, schreibend nach außen zu stülpen. Die Wirkungsgeschichte betreffend könnte man hundert Jahre nach seinem Tod fragen, ob Ishiguro etwa ein Kafka-Nachfolger sei? In einem weiteren Sinn stellt sich damit das Problem des Vorläufertums. Borges hat den Spieß umgedreht: Kafka erzeugt seine Vorläufer, aber nicht: Die Vorläufer erzeugen, ermöglichen ihn. Kafka ermöglicht eine andere Sichtweise, eine andere Lektüre von Kleist. Durch Kafka entsteht retrospektiv ein anderer, neuer Kleist. Das wäre eine rationale, nicht-mystische Interpretation des Borges-Theorems. Es ist eine Art, die Literaturgeschichte gegen den Strich zu bürsten. Das schaffen in erster Linie die Werke, nur in zweiter Linie die Interpreten, mögen sie auch Walter Benjamin heißen. Aber Literatur ist natürlich immer auch Interpretation, besonders die von Borges. Und es gibt sie weiterhin, die Nachfolger, von den Vorläufern prospektiv erzeugt. Wir alle sind immer auch Nachfolger. Erben, sagte man früher. Jetzt oft: Intertextualität. Wir sind intertextuelle Knilche, die den Supermarkt der (Literatur-)Geschichte plündern und sich mit fremden Federn schmücken. Schön, deine fremden Federn!
Ishiguro läßt bewußt, glaube ich – bewußt, d. h. erzähltechnisch –, eine Menge Zuordnungen und Bestimmungen offen, aber die Geschichte erschließt und schließt sich trotzdem, sie kommt zu einem Ende, ganz konventionell. (Ich lese gerade seinen ersten Roman, A Pale View of Hills, der in Nagasaki spielt.) Ganz anders funktionieren die Romane Kafkas, da gehen die Öffnungen immer weiter, eine Öffnung führt in die nächste, wie eine Zimmerflucht in einem riesigen Schloß, ein Rätsel führt zum nächsten, der Roman bleibt notgedrungen fragmentarisch, während bei Ishiguro die detektivische Wißbegierde soweit befriedigt wird, daß Autor wie Leser den Roman am Ende zufrieden, wenn nicht erleichtert aus der Hand legen können: Was man wissen kann, das wissen wir jetzt.
Im Dunkeln bleibt die Macht, die alles beherrscht und bestimmt, man weiß nicht genau, wie. Die Protagonisten möchten den Mechanismus der Macht kennen, um ihm entkommen zu können. Das ist dann doch wie bei Kafka. Der Landvermesser im Schloß möchte allerdings nicht entkommen, er möchte sich eingliedern. Genau das gelingt ihm nicht, es ist ein Roman des Scheiterns, wie alle Romane Kafkas. Ein scheiternder Roman. Ähnlich in Wilde Schafsjagd von H. Murakami, nur daß die Erzählung hier in der Gußform eines Krimis abläuft. Krimis sind dazu da, um Aufklärung zu schaffen. Im Lauf der Zeit gerät dieser Anspruch in eine tiefe Krise. Jedenfalls in der ernsthafteren Literatur, während Whodunit-Krimis auf dem Markt der Texte und der Bilder inflationär wuchern. Die Postmoderne respektive Post-Postmoderne ist schizophren.
Vor vielen Jahren war ich einmal in Buenos Aires bei María Esther Vázquez zu Besuch. Sie war als junge Frau Vorleserin und Sekretärin des nahezu blinden Jorge Luis Borges gewesen und hat später eine Biographie des Autors verfaßt, die ich für die beste bis dato erschienene halte. Sie erzählte, daß sie eine Zeitlang den Ulysses von Joyce lasen und Borges dann, erschöpft von der anstrengenden Lektüre, sie darum bat, doch ein wenig Kipling vorzulesen, zur Erholung gewissermaßen. Kipling gehörte zu den Kindheitslektüren von Borges, die zum Teil in englischer Sprache stattfanden. Als Zehnjähriger übersetzte er Der glückliche Prinz von Oscar Wilde ins Spanische, die Übersetzung wurde im Feuilleton der Zeitung Clarín veröffentlicht. Als alter Mann – noch nicht gar so alt, etwa so alt wie ich jetzt – hatte er das Bedürfnis, zu den frühen Erfahrungen und Prägungen zurückzukehren. Zurück zur Einfachheit, weg von halsbrecherischer Sprachakrobatik. Vielleicht sollte man als Autor die Sprache und die Genres nicht endlos ausreizen, den Motor nicht heißlaufen lassen. Bei mir selbst merke ich eine solche Tendenz, eine wachsende Abneigung gegen überanstrengte, überanstrengende Lektüre. Sprachliche Verdichtung, ja, aber gerade beim Erzählen braucht es Leerstellen, durch die Atemluft strömen kann. Beim späten Joyce ist alles restlos verbaut. Noch ein Stockwerk, und noch eines. Türme zu Babel, die eifrigen Baumeister. Auch ein ausgeleiertes Motiv.
Transversale Verbindungen zwischen den Zeiten, um sowohl die Ausrichtung auf die Zukunft als auch die auf die Vergangenheit zu unterlaufen. Als Lektüreplan, aber auch beim Schreiben, als Weg zur Zeitlosigkeit. Solche Schnitte können durch die Jahrhunderte gehen, aber auch durch die wenigen Jahre der eigenen Lebensgeschichte, das spielt keine Rolle. Literatur, die diesen Namen verdient, ist inaktuell, unzeitgemäß, sie wendet sich von aktuellen Themen ab oder bohrt in deren tiefste Schichten hinein, um Essentielles herauszuholen. Was mich betrifft, ich wende mich inzwischen auch von der aktuellen Umgangs- und Mediensprache ab (was heutzutage fast dasselbe ist), z. B. vom Wort »aktuell«, das jetzt oft statt »derzeit« gebraucht wird. Die derzeitige Sprache – im deutschen Sprachraum, von den Medien vor allem im Internet gesteuert – ist oft falsch und verdeckt die Dinge, die sie zu erhellen vorgibt. Beispiel: Wir trachten danach, die diversen Gruppen einzuschließen wie in ein Gefängnis, und die Wahrheit ist, daß Individuen in einem fort ausgeschlossen werden. Wir sind nicht mehr vielfältig, sondern divers. Usw. usf. (die Entwicklung der Sprache ist aktuell nicht mein Thema).
Als Leser begebe ich mich dank Scott Fitzgerald in die Welt der Zeit von New York um 1920, und gleichzeitig tue ich mich dank Manuel Puig im Buenos Aires der vierziger Jahre desselben Jahrhunderts um. Oft sind Romanwelten nicht zeitlich lokalisiert – »wann« spielen zum Beispiel die Romane Kafkas? In Der Verschollene lassen sich auf diese Frage noch Antworten geben –, »lokalisiert«, ein anderes, nicht-räumliches Wort steht hier nicht zur Verfügung –, sie eröffnen und verbreiten ihre eigene Zeit, die sich in Jahren und Minuten und Jahreszahlen nicht benennen läßt. Trotzdem gefällt es mir, im New York oder Long Island des Jahres 1920 oder in einer Kleinstadt der Provinz Buenos 1943 umherzuspazieren, mal hier, mal dort, es gibt Verbindungswege, die ich mir notfalls selbst schaffe.
In der Provinz, aus der ich stamme, lautete ein oft gehörter Spruch: »In die Menschen kann man nicht hineinschauen.« Das stimmt; wie so viele Sprichwörter und Redewendungen ist es eine Binsenweisheit. Es gibt allerdings eine Ausnahme von dieser Weisheit: die Literatur. Die Literatur und den Film, aber bei letzterem sind Zweifel angebracht, weil sich Schauspieler ja doch nicht so öffnen wie es eine Romanfigur tut und die beste Kamera nicht so wendig ist wie der menschliche Blick. Wir können der Romanfigur, ob sie nun »ich« sagt oder ob von »ihm« oder »ihr« die Rede ist oder gar ein Du oder Wir vorkommt, die ganze Palette des grammatischen Genus – wir können ihr folgen wie ein Stalker, in der Literatur ist das erlaubt, wir können ihr über die Schulter schauen und sogar in ihr Inneres eindringen, ohne auf Interpretationen des äußeren Erscheinungsbildes angewiesen zu sein, können da drinnen mitleben, fremde Gefühle empfinden oder Erschütterungen erfahren, die für eine Weile zu den eigenen werden, wir können Gedanken mitdenken und umdenken, sogar beim Träumen sind wir dabei. Darin liegt die Stärke der erzählenden Literatur und ihre Unverzichtbarkeit. Diesen Satz schreibe ich sehr bewußt und wiederhole ihn: Ohne Literatur keine Menschlichkeit, wie wir sie kennen (as we know it). Ohne Literatur, ohne Lektüre von Literatur nimmt ein Trans- und Posthumanismus überhand, von dem wir heute noch nicht sagen, allenfalls ahnen können, was er bringen wird. Ihrer wesentlichen Rolle nach ist Literatur heute, im 21. Jahrhundert, zwangsläufig konservativ.
© Leopold Federmair