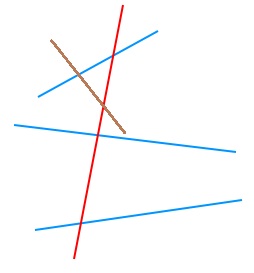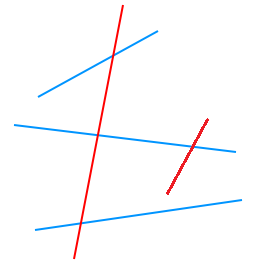Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Musil hat einen großen Denkaufwand betrieben, um die Form des Essays in den Roman einzuführen. In Wirklichkeit hatte der Essay immer schon ein Heimatrecht in den Gefilden des Romans, denn jede erweiterte Reflexion einer Figur (z. B. über ihr Handeln) oder des Autors (z. B. über den Text, über Probleme, die er aufwirft, oder über eine Figur) nähert sich der Form des Essays. Was sind die großen reflexiven Passagen in Thomas Manns Zauberberg, dessen Niederschrift er etwa gleichzeitig mit Musils unvollendetem Mann ohne Eigenschaften begann und – anders als Musil den seinen – in regelmäßigem Arbeitstempo mehr oder minder plangemäß zu Ende brachte, anderes als Essays? Auch die Dialoge tendieren bei Gesprächspartnern wie Naphta und Settembrini zum Essayismus, einfach deshalb, weil jeder der beiden so viel zu sagen hat. Nur hat es Thomas Mann nie der Mühe wert gefunden, die essayistischen Merkmale seiner Romane besonders hervorzuheben und mit theoretischen Erläuterungen zu versehen. Wozu auch, er hatte genug damit zu tun, Figuren zu schaffen und reden zu lassen. Auch Musil hatte genug damit zu tun, und vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich darauf beschränkt. Vielleicht, vielleicht nicht. So ist er als Theoretiker des Essayismus berühmt geworden.
Thomas Manns Romane sind als Lektüre für alt gewordene Leute mit einer langen Lesergeschichte bestens geeignet – vorausgesetzt, man will noch ein wenig Lebenszeit dafür aufwenden. Solche Leser brauchen nichts Auf- und Anregendes mehr, wohl aber Balsam für ihre geschundenen Nerven. Zum Beispiel Lotte in Weimar, dieser essayistische Plauderroman, wo mehr oder minder ungebetene Besucher einem alten Weiblein die Ohren mit ihren Problemchen und Projekten, Enttäuschungen und Beschwerden vollquatschen – à propos Essayismus, die gute Frau braucht kaum Fragen zu stellen, schon gehen die Sermone los, jeder und jede hat sein oder ihr Scherflein zur Geschichte vom großen Mann, seiner Exzellenz, dem Geheimen Rat Goethe beizutragen. Ein mehrstimmiger Essay, eine Analyse jener »Größe«, die Thomas Mann so sehr begehrte, deren Mechanismen er erforschen wollte.
Da lob ich mir Kafka, diesen kleinsten aller Schriftsteller, der am liebsten einen Bau bewohnt hätte. Einen unterirdischen, wohlgemerkt: Wir bauen den Schacht von Babel. Ist noch wer übrig von diesem Wir? Kafka schrieb keine Essays, das hatte er nicht nötig. Seine Figuren plaudern auch nicht so viel, und meist erhalten sie keine Antwort.