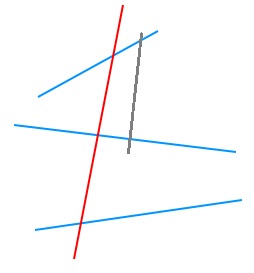Transversale Reisen durch die Welt der Romane
In der poetologischen Korrespondenz Aus der Zukunft des Romans zwischen Olga Martynova und mir, zu der sich dann andere Autoren gesellten und die sich über fast zwei Jahre erstreckte, fragt Kurt Neumann, das ganze Konvolut überblickend, ob die Zukunft des Romans nicht eine minimalistische sei. In der Tat neigte vor allem Olga immer wieder zur Kürze; auch Anna Weidenholzer teilte am Ende mit, sie wolle künftig Erzählungen in der Art von Raymond Carver schreiben, und zitierte Hemingways berühmte Eisberg-Theorie: »Alles, was man eliminiert, macht den Eisberg nur noch stärker. Es liegt alles an dem Teil, der unsichtbar bleibt.« Sich aufs Wesentliche konzentrieren – sofern man weiß, was das Wesentliche ist. Bei mir selbst entspricht diese Tendenz meiner späten Entdeckung der kleinen Romane à la Modiano. Ich denke mir auch, daß wir auf schweres Gepäck künftig verzichten sollten, und in der Wirklichkeit reise ich genau so, nicht mal einen Reiseführer brauche ich, keinen Computer, nur ein Handy, für Hotelreservierungen. Und dann sollten wir vielleicht aufs Reisen überhaupt verzichten… Zu anstrengend, bringt die natürlichen Lebensabläufe durcheinander.
Andererseits schreiben bei weitem nicht alle Romanautoren minimalistisch. Hin und wieder gibt es gegengerichtete Strömungen, oder soll man sagen: Moden? »Achtung, die dicken Romane kommen!«, kündete – oder warnte? – Paul Jandl im Sommer 2018 in der neuen Zürcher Zeitung. Offensichtlich ein Artikel auf der Grundlage von Verlagskatalogen, die in vielen Fällen wohl die Lektüre der Bücher ersetzen. Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen, von Philip Weiss, ist dabei, gut 1000 Seiten, eigentlich aber fünf Romane, und auch Schattenfroh, von Michael Lentz, ein Buch, das ich inzwischen – Sommer 2021 – gelesen habe, quergelesen, um ehrlich zu sein, der Roman spielt keineswegs, wie der irregeleitete Jandl meint, in China, sondern im Kopf des Autors, und der ist ziemlich weitläufig, weitläufiger als China.
Hinzu kommt, und das ist jetzt wirklich peinlich, daß ich als Autor trotz neuer Vorlieben als Leser immer noch so schreibe, wie ich es vor einem Vierteljahrhundert zu rechtfertigen suchte, indem ich einen manifestartigen Text verfaßte: Für eine barocke Literatur! Unter »barock« faßte ich Eigenschaften wie ausufernd, schweifend, wuchernd, verschnörkelt, vieldimensional, lang-weilig (im Adalbert Stifterschen Sinn) zusammen – alles, was die stramme deutsche Literaturkritik seit dem Ende des letzten Weltkriegs verpönt. So schreibe ich veraltet in die Zukunft hinein… Peter Handke hat ja auch solche Bücher gemacht, nur hatte er nichts mit dem Barock am Hut, hat vielmehr seine Epen an fast schon prähistorische Zeiten anschließen wollen: Gottfried von Straßburg wurde zum Schutzheiligen ernannt. Bei manchen Autoren ist das Neobarock eine Alterserscheinung, die Konzentrationskraft scheint ihnen abhandengekommen, ein biologischer Vorgang. Junger Autor = Gedichte, rasante Erzählungen; alter Autor = behäbig ausufernde Romane.
Aber wie gesagt, ich habe versucht, das Genre so zu definieren, als barockes. Und wie gesagt, der Romancier frißt alles und verwurstet alles. Schreibt der Autor einen Roman, darf er sich gehen lassen, allerdings auf die Gefahr hin, sich im Wörterwald zu verirren, auf unwegsames Gelände zu geraten, die Ariadnefäden zu verlieren und nie ein Ende zu erreichen, wie es Musil mit dem Mann ohne Eigenschaften passiert ist, bis ihn der Tod in der Badewanne erlöste. Schreibt der Autor eine Erzählung, sind Ökonomie und Fokussierung gefragt (Musil im präkakanischen Erzählband Drei Frauen). Sparsamkeit. Économiser heißt sparen. Nicht zu viel sagen. Manche Autoren schaffen den Wechsel zwischen beiden Seiten, ein heiteres Hin-und-Her. Julio Cortázar zum Beispiel, vom Verfolger zu Rayuela zu Das Feuer aller Feuer zu 62/Modellbaukausten. Oder Kafka, weniger heiter, weil von einer ungreifbaren Inspiration schmerzlich abhängig. Wenn’s läuft, dann läuft’s, und es kommt ein Roman in die Gänge, der ein Ziel haben mag, aber keinen Weg: Was der Autor »Weg« nennt, ist nichts als sein endloses Zögern. Schreibend zögern, zögernd schreiben. Auf der anderen Seite: die extrem fokussierten Texte, die wahrhaft minimalistischen, die mit wenigen Sätzen auskommen und überhaupt nicht Gefahr laufen, sich noch einen Millimeter weiterzubewegen. Gib’s auf! Ich gehe jetzt und schließe. Das ist die Literatur, die als Axt wirkt und irgendein Eismeer zertrümmern soll oder kann. Mit einem Schlag? Mit einem Schlag, dem Schlag ans Hoftor. Auch wenn er realiter gar nicht stattgefunden haben sollte.
Bei Ingeborg Bachmann zeigen sich diese Verhältnisse in biographischer Abfolge. Dem berühmten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zufolge besaß sie ein lyrisches Talent und hielt damit auch nicht hinter dem Berg. Dann verlegte sie sich auf Erzählungen, mit denen sie ebenfalls Erfolg hatte. Sie bildete sich ein, keine Gedichte mehr schreiben zu wollen oder zu können. Und dann, als sie das dreißigste Lebensjahr schon deutlich überschritten hatte und sich alt zu fühlen begann, begann sie auch noch mit dem Romanschreiben. Abgesehen von Malina, wo sie sich in Traumaufzeichnungen verirrt und verliert, hat sie keines der nicht wenigen, ausufernden, unabgeschlossenen Romanmanuskripte zeitlebens veröffentlicht. Eine tragische Entwicklung, aber nicht untypisch. Male oscuro. Dunkles Übel. Melencolia. Sie starb mit 46, und vielleicht war sie selbst es, die nichts mehr von sich erwartete.
Diese vorsätzlich in die Breite gehenden, »epischen« Romane kommen oftmals dadurch zustande, daß die eigentliche Erzählung, also die Geschichte, um die es gehen könnte, ein ums andere Mal aufgeschoben wird. Eine Art Feigheit vor der Geschichte. Jean Paul erzielt denselben Effekt durch Unmengen von Vorreden.
Hingegen jene Autoren, die gern in medias res gehen. Da bricht urplötzlich eine andere Welt herein. »Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.« Oder auch bei Kleist, einem Lieblingsautor Kafkas: »In St. Jago, der Hauptstadt des Königreichs Chili, stand gerade in dem Augenblicke der großen Erderschütterung vom Jahre 1647, bei welcher viele tausend Menschen ihren Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrechen angeklagter Spanier, namens Jeronimo Rugera, an einem Pfeiler des Gefängnisses, in welches man ihn eingesperrt hatte, und wollte sich erhenken.« Ohne die kleinste Verzögerung geht es los mit der Geschichte. Kleists Schachtelsätze ändern daran nichts.
Ein paar Worte zu jenem anderen Barock-Romancier, der in unbarocken Gewässern segelte. »Und ich hasse doch alles Erzählen so sehr«, schreibt Jean Paul irgendwo im Quintus Fixlein, diesem unlesbaren Buch – aber es soll Leute geben, die sich daran delektieren. Natürlich haßt er oder der Erzähler oder wer auch immer nur ein ganz bestimmtes, wohlgeordnetes, geradliniges Erzählen. Lieber macht er Sprünge, schweift ab, verliert sich, gibt Späße zum Besten, hakt sich irgendwo fest. Aber zu diesem Vergnügen verhilft ihm eben doch das Erzählen, seine Art des Erzählens!
Eine Methode, den Erzählfluß zu hintertreiben, sind – neben Vorreden – Fußnoten. Dank der vielen Fußnoten erkennt man schon am äußeren Schriftbild die Barockizität eines David Foster Wallace. Und natürlich daran, daß die sprachlichen Blumen, also Metaphern, die eigentliche Erzählung großflächig überwuchern. Blumige Sprache, ja, gepaart mit stellenweise harter Direktheit, wie wenn sich ein Kameraauge einen Sekundenbruchteil eben doch auf rohe Wirklichkeit öffnet. Kein romantischer Barock, eher: Punkbarock. Punkt.
Ich weiß nicht, warum ich mich in unserer Korrespondenz über die Zukunft des Romans so gegen Arno Schmidt sperrte. Gegen Schmidt, und insgeheim auch gegen Joyce, den er als junger Autor angeblich überhaupt nicht gelesen hatte, obwohl man ihn (Schmidt) nach wenigen Sätzen, egal wo aufgeschlagen, für einen Joyce-Epigonen hält. Was mich an beiden – jedenfalls heute, jetzt – stört, ist nicht ihre Verspieltheit, sondern ihr Hyperrealismus. Sie müssen alles und jedes bis ins kleinste Detail anführen, gar sezieren. Unter dem »totalen Roman« tun es solche Autoren nicht. Da lob ich mir dann doch, bei aller Liebe zum Barock, die altjapanische Malerei, wo ein Kirschzweig mit zwei, drei Blüten ganz locker den ganzen Baum und am Ende einen Hain repräsentieren kann. Wozu die Unzahl von »kleinen Einförmigkeiten« darstellen? Genau dieses Allesprotokollierenwollen ist der Fiktion eben nicht angemessen. Und muß zwangsläufig ein Ausufern zur Folge haben. Dabei beruft sich Arno Schmidt auch noch auf »Wahrheit« (jedenfalls nach Robert Striplings Beitrag in der Korrespondenz, der folgendes zitiert). Es gehöre zu den »vornehmsten Kennzeichen jener (›unserer‹) Gruppe extremster Realisten, dass man sich um der Wahrheit willen der Fiktion pausenlos=aufgeregter Ereignisse verweigert«. Auch eine Form, »Handlungsleere« zu rechtfertigen! Zu den kleinen Einförmigkeiten kommt dann noch die ständige Reflexion über diese, der ganze Bewußtseinsstrom eines beliebigen Subjekts. Klar finden Bücher, die das bewältigen wollen, kein Ende. Aber sollte Literatur nicht genau das sein: kompakt und überraschend, im Gegensatz zum vollgestopften, zäh fließenden, sich immer und immerzu wiederholenden, zunehmend monotonen, am Ende erstarrten Leben?
Jetzt redest du schon so wie die Erzählökonomen. Streichen-Kürzen-Streichen als Kardinaltugend des Schreibenden.
Aber letzten Endes ist es doch so: ALLES läßt sich nicht abbilden. Totalität ist schlicht unmöglich. Wie was in den Gehirnkasten und also in den Buchziegel kommt, bestimmt der Wahrnehmungskanal (und Denkkanal), mit dem jeder einzelne ausgezeichnet und geknechtet ist. Und Wahrnehmung ist stets selektiv. Auch schreibende Darstellung ist dann wieder selektiv. Sie mag ein ALLES-Projekt entwickeln, nur kommt sie dann nicht mehr vom Fleck, was entsteht, ist keine Erzählung, sondern eine Müllsammelstelle, eine weltumspannenwollende Collage. Nein, die Welt kann man nicht wiederholen. Wir orientieren uns in Sinnfeldern, nicht in »der« Wirklichkeit. Hat mal jemand gesagt.
Jean Paul-Lektüre soll Spaß machen, macht aber nur Mühe. Zum Beispiel mit der »fortgesetzten Vorrede zur zweiten Auflage«, wo sich die Fußnote findet: »Man schlage allemal zur frühern Fortsetzung zurück, um den Zusammenhang zu finden.« (Quintus F.) Hier ist wirklich einmal der aktive Leser gefordert!
J. P. spielt unablässig mit der Fiktionalisierung, springt spielerisch-humoristisch zwischen den Ebenen hin und her. Wirkliche Figuren sind fiktionale, und umgekehrt. Im Lesevorgang nehmen wir nun mal fiktionale Figuren als (wie) wirkliche. Wir sehen sie, fühlen, leiden, freuen uns mit ihnen. Auch der wirkliche Autor wird auf die Ebene der Fiktion geworfen. Später, Anfang des 20. Jahrhunderts, noch rückhaltloser: Sechs Personen suchen einen Autor. Oder Macedonio Fernández, Museo de la novela de la Eterna, das übrigens mehr als fünfzig Vorreden enthält, damit die eigentliche Geschichte, falls es sie gibt, nicht beginnen muß.
Mühsam heißt fordernd; aber nicht alles Fordernde ist auch gut; und nicht jede Mühe lohnt. Vermeidung von Mühe führt aber auch nicht automatisch zum Spaß.
Bei J. P. lese ich zum Beispiel einen Satz über »die großen Gerüste der Natur, welche die Seele wie Reben stengeln« (Quintus Fixlein), und verstehe ihn zunächst einmal gar nicht. Gerüste der Natur, ich weiß nicht, was das sein soll, ein rechtes Bild davon will sich nicht einstellen. Gerüste der Natur… Bäume, oder was? Die in den Himmel wachsen? Und dann noch Reben, die stengeln. Ich schlage in Grimms Wörterbuch nach, finde: »mit pfählen, mit stangen stützen, mit stöcken verschlieszen«. Beim Weinbau stützt man die Reben durch Stangen, das ist es wohl? Und die Natur stützt auf diese Art die Seele? Die Natur insgesamt, oder ein bestimmtes Gestänge? Ich komme nicht weiter, die Bedeutung bleibt abstrus. Vielleicht meint Jean Paul ja bloß, daß schöne Naturerlebnisse die menschliche Seele stärken. Triviale Aussage… Aber wenn das Wort »Reben« in dem zitierten Satz nicht Objekt ist, sondern Subjekt, was eigentlich eher zutreffen sollte? Dann verstehe ich wiederum gar nichts. Ist auch nicht weiter schlimm, in einem umfangreichen Roman überspringt man solche Sätze. Oder man greift zu weiteren Wörterbüchern, verliert sich in ihnen. Bei J. P. müßte ich freilich jeden zweiten Satz überspringen. Mindestens.
Seine Romane enthalten unzählige Sätze und ganze Passagen wie diesen. Wenn auch ich mir einen Vergleich erlauben darf: Seine Sätze sind wie die Erker an einem Haus, das nur aus Erkerzimmern besteht. Die Verzierungen überwiegen die Substanz, das Werk besteht überhaupt nur aus Schnörkeln. Wie Windgebäck, noch ein Vergleich. Dazu das Verschachtelungsprinzip, jede Monade steckt in einer anderen, man wird mit dem Auspacken nicht fertig. Wie bei einer gigantischen russischen Puppe. Jeder Satz ist letztlich ein Exkurs zu einem Text, den der Autor – und damit der Leser – überhaupt nie in Angriff nimmt. Und die Exkurse, wie die Vorreden, betreiben nichts als Flucht vor dem verhaßten Erzählen. »Nur ein Extrawort über die Vokationen-Agioteurs überhaupt«, lautet eine Zwischenüberschrift im Roman. »Agioteur« ist ein altes Wort für Börsenspekulant. Was Vokationen sind, konnte ich nicht herausfinden. Auch aus Mangel an Geduld: Mir vergeht die Lust, zu erfahren, worum es sich bei dem Exkurs handelt.
Vielleicht kann mir jemand sagen, worin solcherlei Lust besteht? Ich hatte einen Freund, der bezeichnete sich als Jean Paul-Fan. Er war selbst eine Zeitlang Schriftsteller, veröffentlichte damals zwei Romane, bevor er sich einem anderen Beruf zuwandte. Den ersten Roman, der wohl in seiner Biographie verankert war, fand ich gut und witzig, witziger jedenfalls als Jean Paul; den zweiten heillos überladen mit witzigen oder witzig sein wollenden Episoden, so daß ein nur mittelmäßig begabter Leser die vielen Figuren nicht auseinanderhalten konnte. Unfreiwilliges Barock.
Also doch, am Ende der diskursiven Schleife: ein Plädoyer für den Minimalismus!
Nun ja, zwei Seelen wohnen (mindestens) in meiner Brust. Zwischen zwei Buchseiten finde ich einen Notizzettel aus jener Zeit, auf dem steht Wort für Wort: »Da dachte ich, ich hätte mich zum Minimalismus bekehrt, und jetzt begeistert mich Jean Pauls barockes Erzählen! Dieses ausgelassene, ungebremste Erzählen! Und das rundum Positive in der Figur des Quintus Fixlein! Einschließlich seiner Rührseligkeit, seiner Empfindsamkeit. Der schrullige Mann ist mir auf ungeahnte Weise nahe.«
Einzelne Metaphern werden flugs zur Allegorie, die jede Menge Selbstreflexion enthält: Der Autor ist »eine Art Bienenwirt für den Leser-Schwarm, dem zu Gefallen er die Flora, die er für ihn hält, in verschiedene Zeiten verteilt und die Aufblüte mancher Blumen hier beschleunigt, dort verschiebt, damit es in allen Kapiteln blühe. (…) Die Göttin der Liebe und der Engel des Friedens führten das Ehepaar auf Steigen, die über volle Auen liefen, durch den Frühling und auf Fußpfaden, die in hohen Kornfeldern verborgen waren, durch den Sommer – und der Herbst streuete ihnen, als sie auf den Winter losgingen, seine marmorierten Blätter unter. Und so kamen sie an vor der niedrigen dunkeln Pforte des Winters, voll Leben, voll Liebe, zuversichtlich, zufrieden, gesund und rot.«
Schön, oder? Und immer ein bißchen (selbst-)ironisch. Gesund und rot. Wie bei Eichendorff: »Und es war alles, alles gut.« Wie sehnt sich der leidgeprüfte, schwierige Literatur durchackernde Leser nach so einem glatten Happy End. Im Ernst! (Fast) ohne Ironie!
Aber jetzt fällt mir noch ein anderer Schlußsatz ein, der ist hintergründiger, weil von Ödön von Horvath: »Es geht immer besser, besser – immer besser.« Wir sind ins 20. Jahrhundert gesprungen, genauer: in seine erste Hälfte. Noch genauer: ins Jahr 1929.
Der Erzähler schwebt hier durch die Erzählung wie ein Geist, ein unsichtbarer Engel wie in Thomas Stangls Roman Was kommt oder wie die Engel in Wenders‘ Film Der Himmel über Berlin. Er schaut den Figuren dezent über den Rücken, greift aber nicht ein, obwohl er das vielleicht manchmal wollte (wir wissen es nicht). »Ich zog nach meiner Art wie ein Geruch im ganzen Hause herum…«
© Leopold Federmair