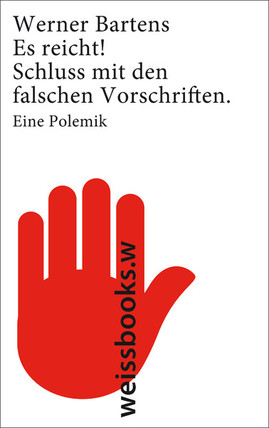Seit siebzehn Jahren, fast so lange, wie ich in Japan lebe, besitze ich dieses Sakko. Ich trage es gern, es ist bequem, etwas weit, schwarz oder von einem sehr dunklen Blau, bei Sonnenlicht glitzert die Oberfläche manchmal ganz leicht (kommt mir vor). Im Winter ist es recht warm, im Frühling und Herbst nicht zu warm, in Wahrheit aber von bescheidener Qualität, filzig, ein wenig ausgebeult, Staub und Härchen und Fussel bleiben am Stoff haften, so daß ich oft daran herumzupfe und ‑wische. Gekauft habe ich es mitten in einem der engen Gäßchen eines Markts neben dem großen Atsuta-Schrein in Nagoya, von einem chinesischen Händler, der die Stücke in kleineren Mengen vom Festland auf die Insel brachte. Bei Lesungen und ähnlichen Gelegenheiten trage ich das Sakko gern, weil ein Schriftsteller nicht gar zu elegant wirken sollte, ich andererseits aber doch etwas darstellen möchte, einen Verfasser von Büchern, einen maker, einen poeta faber; einen, der etwas von seinem Handwerk, den Wörtern und Sätzen, versteht.
Da traf es sich gut, als mir in der Alten Schmiede, dem Ort in der Wiener Innenstadt, wo sich die Dichter und immer auch ein paar Hörer treffen, einer der Macher dort, ein Fädenzieher im Hintergrund, glaube ich – so jedenfalls sieht er sich selbst –, ein kleines rotes Ding in die perplexe Hand drückte: einen Hammer. Den konnte, den sollte ich anstecken, und das tat ich, ans Revers meines dunklen Faber-Sakkos, das traf sich gut, da paßte es hin, Rot auf Schwarz, rouge et noir, winzig klein vor dem ozeanischen Hintergrund, dem umhüllenden Schwarz, ein Blutstropfen, aus der Ferne gesehen. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses…
Die Kämpfe; Schwächen und Stärken. Der Macher hatte mit dem Auge gezwinkert, oder zumindest verschmitzt dreingeschaut. Der kleine Hammer war doch ein Symbol, er verwies auf etwas; etwas anderes, das er nicht selbst war, mit dem er vielleicht in Zusammenhang stand, das er aber nicht war. Richtig – mir ist es erst viel später aufgefallen, beim nächsten oder übernächsten Mal in der Schönlaterngasse, in der ich noch nie eine schöne Laterne gesehen habe – richtig, da hing es, das Symbol, über den Köpfen der Passanten, der Dichter und Hörer und Nachtschwärmer, da hing es, elektrorot, um ein Vielfaches größer als das Symbolchen an meinem Revers, aber unauffällig im Vergleich zum Schlüssel, dem schmiedeeisernen, ewigen, der da ebenfalls hing, etwas protzig, nicht wahr? Also Schmiede, Hammer, Werkzeug, Mittel zu… Eine Metonymie, keine Metapher.
Ab und zu werde ich gefragt, was der kleine Hammer zu bedeuten habe und warum ich ihn trage; andere Male sehe ich am Gesichtsausdruck meines Gegenübers, daß es irritiert ist, sich vielleicht sogar bedroht fühlt, wie ich mich vom schmiedeeisernen Schlüssel bedroht fühlte. Was hätte ich denen, die sich zu fragen getrauen, antworten sollen, was soll ich ihnen sagen? Sicher, das Symbol des Kommunismus, Hammer und Sichel, beide Werkzeuge zusammen, gekreuzt, Arbeiter und Bauern, Hufe für Pferde und Gras für Kühe, vorindustrielle Symbole, wenn man’s recht bedenkt, also romantisch, keine Angst, oder doch, Angst vor dem Unheimlichen, nicht zu Durchschauenden. Eine Zeitlang in meiner Jugend dachte ich, der Kommunismus könnte wirklich schöne Verhältnisse für uns alle bringen, Zuckererbsen für jedermann, Bücher für alle Schulkinder, also jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten. Schöne Ideale! Wenn man jeden tun läßt, wie er will, wird dieser Jedermann, Mister Ninety-Nine Percent, auf der faulen Haut liegen bleiben, keinen Hammer und keine Sichel anrühren, sondern sich eine Flasche Bier grapschen und Fußballspiele oder Pornos oder Shoppingteaser in sein Hirn reinziehen, und wer sorgt dann für die Bedürfnisse bzw. die Güter, die sie befriedigen. Unmöglich – das habe ich irgendwann eingesehen (nachdem ich mich sogar ein bißchen »engagiert« hatte). Trotzdem finde ich die Idee eines solchen Blumenwiesenkommunismus immer noch schön und will nicht ganz von ihr lassen. Flower Power! Vielleicht ist das ja ein Grund, einer der Gründe, warum ich das kleine rote Hämmerchen am Revers trage: eine halbe Hoffnung. Und der Grund, warum der Macher von der Alten Schmiede die Dinger in der Rocktasche bei sich trägt, um gegebenenfalls eins in eine warme Handfläche gleiten zu lassen. Aber der meint das doch anders, konkreter, das Rote ist für ihn eher etwas wie der Faden auf dem unendlichen Marsch durch die Institutionen, dieses Labyrinth, in dem man sich schon mal verirren kann oder, um die Wahrheit zu sagen, sich dauernd und dauerhaft verirrt.
Weiterlesen ...