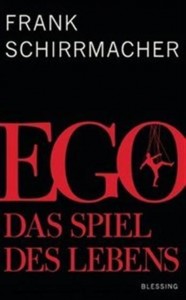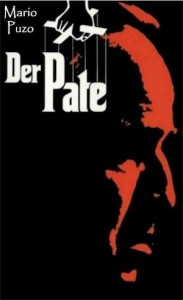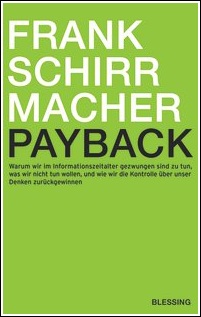Die digitale Welt, die seit einigen Jahren eruptiv die Lebensgewohnheiten der Menschen zu verändern scheint, hat einen neuen Rechtsbegriff hervorgebracht, der den revolutionären Impetus auf eine neue, in Windeseile errichtete Umgehungsstraße umleiten möchte und den wirren Verkehr auf den Datenautobahnen entlasten soll. Es ist die Rede vom »Recht auf Vergessen« bzw. »Recht auf Vergessenwerden«, welches durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Ordnungssehnsucht des analogen Biedermanns zu erfüllen trachtet.
Das Urteil gestattet ab sofort praktisch jedem die über ihn abgespeicherten Hinweise, die eine Suchmaschine findet, deaktivieren zu lassen. Der vom Link betroffene Inhalt selber wird dabei weder geprüft noch ist er Gegenstand des Interesses. Er muss nicht entfernt werden, was auch entbehrlich ist, da im digitalen Vollrausch der Überbringer längst zur wichtigsten Person wurde. Erleichtert stellt man fest, dass George Orwells Dystopie des Zeitungsfälschens je nach politischer Großwetterlage praktisch ausfällt. Hätte Orwell allerdings von Suchmaschinen und dem Internet auch nur eine Ahnung entwickelt, hätte sein Roman ziemlich sicher das Urteil antizipiert.
Die Furcht des Heuristikers
Der Archivar des digitalen Zeitalters ist eine Maschine, die mit von Menschen in eine bestimmte Reihenfolge programmierten Kriterien Medien aufspürt. Wie beim Bibliothekar, der einem früher auf Suchbegriffe hin eine Auswahl präsentierte, sind die Kriterien der Maschine letztlich ungewiss. Überhaupt sind die Gemeinsamkeiten zwischen menschlichen Findern und Maschinen verblüffend: Beide wählen aus, zumeist nach quantitativen Kriterien. Abseitiges kommt eher selten vor. Der menschliche Archivar hat selten eine Seite 2; der in Suchmaschinen agierende Frager verwendet die ihm angebotene zweite Seite ebenfalls sehr selten. Man sucht das schnelle Resultat.
Die Technifizierung der Wissenssuche im Internet ist dem Heuristiker unheimlich. Der Mensch, der gelernt hat, sich als Krone der Schöpfung zu sehen, kann sich nicht damit abfinden, einer Maschine unterlegen zu sein. So hat es Jahrzehnte gedauert bis die Schachspieler akzeptiert haben, dass Computer ihnen in nahezu allen Spielsituationen auf Dauer überlegen sein werden. Menschen sind gezwungen, sich in eine Parallelwelt zweiter Klasse zurückzuziehen. Hier dominiert der Fehler. In der Analyse der Partie entdeckt dann die Maschine, wie es hätte besser weiter gehen können. Die Schadensbegrenzung geht nur noch dahin, dass Menschen bei ihren Wettkämpfen nicht verbotenerweise auf der Toilette die Hilfe der Maschinen abfragen.
Weiterlesen ...