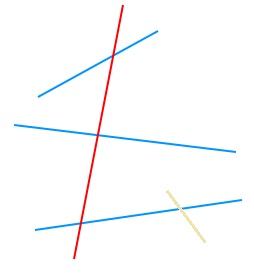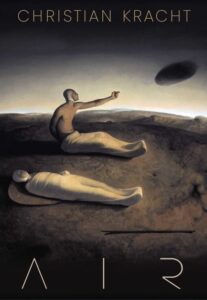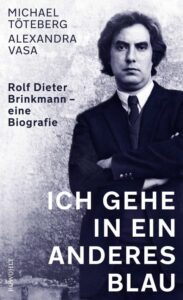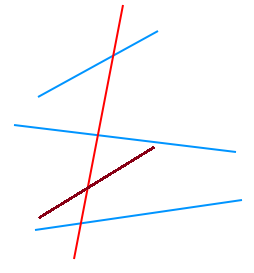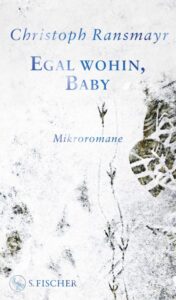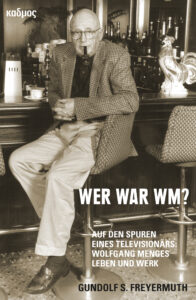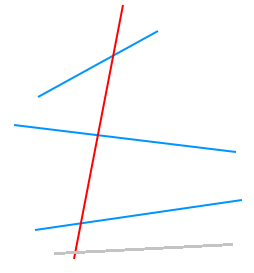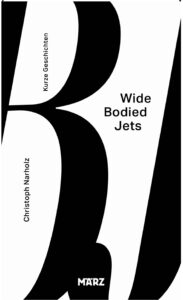
Wide Bodied Jets
Abermals ein Buch mit Notaten, allenfalls kleinen Erzählungen, Capriccios, eine immer stärker sich verbreitende, sanfte Form des Widerstands gegen den Romanfetischismus des Literaturbetriebs. Wide Bodied Jets lautet der Titel; nicht der einzige Anglizismus. Man erfährt, dass damit Transkontinentalflugzeuge bezeichnet werden. Es gibt/gab davon 76 bei der Lufthansa und alle blieben während der Corona-Pandemie am Boden. Und 76 Geschichten sollen es sein, so viele wie Jets. Am Ende sind es mehr als 80.
Es beginnt, wie der Autor es kurz darauf selber nennt, »altmodisch legendenhaft« mit einer Erzählung aus einem kleinen portugiesischen Ort vor zweihundert Jahren, drei hübschen Wirtstöchtern, einem Dauerverliebten und dem Versuch, diese Zeit in der Gegenwart des Dorfes wiederzufinden. Dieser Einstieg erweist sich als Glücksfall, denn danach gibt es den ersten von drei (oder sind es vier?) Selbstdialog-Einschüben. Zunächst wird hier dem Leser das Konzept erklärt, dass all diese Texte in der Corona-Zeit entstanden sind (am Ende heißt es von »Spätwinter 2020 bis Sommer 2022«), dass es wider die »klebrige Traurigkeit von Christian Kracht« (angeblich ein Diederichsen-Wort) geht und dass es viele unterschiedliche Erzähler gibt. So weit, so gut. Im weiteren Verlauf der Selbstgespräche werden allerdings nahezu alle politischen und gesellschaftlichen Themen der Zeit besprochen wie beispielsweise die Schwächen des Liberalismus, die Notwendigkeit einer neuen Rechtsordnung im Anthropozän oder die Reaktionen des Staates in der Pandemie. Ausführlich knetet man die (damals aktuellen) Philosophen, Bruno Latour, Peter Sloterdijk, Boris Groys, Jürgen Habermas und Slavoj Žižek, was bei jemanden, der u. a. über Sloterdijk promoviert hat, nicht ungewöhnlich ist. Natürlich gibt es dann auch Einordnungen zum Überfall Russlands auf die Ukraine (dieser Krieg wird schließlich als »Femizid« klassifiziert).