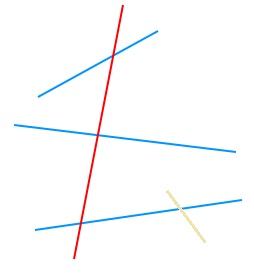Transversale Reisen durch die Welt der Romane
Mut zur Lücke: eine beliebte Wortfügung, oft als Motto verwendet. Wieso man zum Lückenmachen oder ‑lassen Mut braucht, ist mir zwar nicht einsichtig. Meistens werden Lücken einfach hingenommen, unbekümmert oder zähneknirschend. Transversalität lebt gewissermaßen von Lücken. Man kann sie sich auch als Poren vorstellen, durch die der Geist atmet. Zuviel Dichte behindert das Vorstellungsvermögen. Text, Textur, Gewebe: das mehr von Philologen als von Schriftstellern gebrauchte Bild verweist auf lückenlose Strukturen. Texte, in denen / mit denen sich atmen läßt, haben Poren, oder eben Lücken. Sie sind eher mit einer Häkelarbeit vergleichbar als mit einem Gewebe.
Trotzdem streben Dichter, solche von Gedichten wie auch von Prosa, nach Verdichtung, und oft ist ihnen bewußt, daß ihr Text beides braucht, Lücken und Dichte: Unter- und Überdeterminierung. Es gilt, der Bilderphantasie im Kopf des Lesers Raum zu ihrer Entfaltung lassen. Und aus der Sprache, noch aus der schlichtesten Formulierung, mehr herauszuholen, als man – und womöglich der Dichter selbst – sich hat träumen lassen, daß drinsteckt. Das Verbrauchte erneuern, neu beleben. Durch die Poren atmen, Luft hereinlassen durch größere Öffnungen. Luftige Texte, so die Hoffnung, entwickeln einen eigenen Schwung, der den Leser mitnimmt.
Auf das Epos folgt literaturgeschichtlich der Roman. Alte Hypothese. Der »moderne Roman« ist ein Pleonasmus, insofern der Roman mit der Moderne – der ersten europäischen Moderne, die das Mittelalter ablöst – entsteht. Ob die hier und da in der x‑ten Moderne avisierte Wiederkehr des Epos nicht bloß eine Bankrotterklärung des Romanciers ist, dem die Zügel entgleiten? Als Wahljapaner beziehe ich unsere Identität, soweit wir halt eine brauchen, lieber aus dem friedfertigen Genji Monogatari – manchmal als »erster Roman« tituliert – als aus Samurai-Geschichten und Bushido-Büchern, die gewisse Zeitströmungen und einzelne Autoren vorgezogen haben, etwa Yuko Mishima in seinem martialischen Essay Sonne und Stahl. Das Wort »monogatari« würde ich am ehesten mit »Geschichtensammlung« übersetzen, in der Art von Boccaccios Decamerone oder, viel später, Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten oder, noch einmal später, Sebalds Die Ausgewanderten. Versucht der Erzähler, einige oder mindestens eine Figur oder einen in der Erzählwelt präsenten Erzähler über die ganze Sammlung hinweg bei der Stange zu halten oder, noch besser, dessen Entwicklung zu zeigen, erhält man das, was wir immer noch »Roman« nennen. Doch der Begriff ist nach hinten und nach vorne offen. Vielleicht ist der Roman noch heute nichts anderes als eine Geschichtensammlung. Zum Beispiel Handkes Jahr in der Niemandsbucht, als Märchen ausgegeben und dem Epos zuneigend, ist ganz klar eine solche Sammlung, in welcher sieben Freunde ihre Geschichten erzählen und die Erzählungen von einem recht präsenten Erzähler re-präsentiert werden. Ein System von Geschichten, würde ich sagen. Ein System von narrativen Planeten, die um ein Hauptgestirn kreisen, das nicht unbedingt oder nicht immer oder nur indirekt strahlt.
Die Blindengeschichte in Mein Name sei Gantenbein: abstruse Erfindung, reinste Blödelei. Da hat der Autor zwanghaft nach einem »Einfall« gesucht, um die literarische Welt verblüffen zu können. Leute, die nichts zu erzählen haben, am wenigsten von sich selbst, brauchen dringend »Einfälle«.
Am interessantesten sind in diesem Buch noch die Abschweifungen, also die zusätzlichen, teilweise wohl gefundenen, nicht erfundenen, Geschichten. Die zeitgenössische Literaturkritik hatte genau das moniert: Die Abschweifungen stellen die Einheit des Romans auf die Probe (oder sprengen sie). Aber der Roman darf das doch (sage ich), er soll die Einheit auf die Probe stellen, genau wie der Essay.
Bei Max Frisch kommt da etwa ein Bäcker dazu, der dem jungen Liebhaber seiner Frau in die Lenden schießt und ihr das Gesicht zerschneidet. Oder ein Berühmter, der erkennt, wie unwichtig er ist, aber weiterhin den Wichtigen spielt. Das hat Frisch vielleicht von sich selbst erzählt: Ich bin nichts, fühle mich als Nichts, aber meine Umgebung, vor allem der Literaturbetrieb, verlangt von mir, ein großartiges Etwas zu sein. Also tu ich ihnen den Gefallen.
Die peripheren Geschichten sind interessanter, anziehender, erkenntnisreicher als der zentrale Einfall.
Das Romandebüt einer bisher nicht als Erzählerin hervorgetretenen Frau: Christine Vescoli. Sie spricht lange von einem Nichts, von Schweigen und Nicht-Erinnern, worauf schon der Titel hinweist: Mutternichts. Wo das Nichts vorherrscht, dort braucht es Metaphern, die aus dem Nichts ein Etwas machen, auch wenn sie auf keine »eigentliche« Geschichte beziehbar sind, also in der Luft hängen: mehr Lücke als positive Erzählung. Die Metaphern an sich erzählen noch keine Geschichte, sie bilden keine Allegorie. Die unbekannte Geschichte, nach der sich die Erzählerin sehnt, weil es die Geschichte ihrer Mutter wäre. Irgendwann, spät in diesem Buch (und im Leben), beginnt sie doch noch positiv zu erzählen, aus dem unbedeutenden Nichts der hartnäckigen Metaphorik schälen sich Inhaltskerne heraus, die sogar ein wenig zu blühen beginnen. Man könnte auch sagen, die Autorin oder Erzählerin hat eben recherchiert, sie hat spät, aber doch etwas gefunden, das am Ende sogar zu den Metaphern paßt. Wenn Vescoli »doch noch« erzählt, sei es, weil ihr Angehörige aus der – sonst so verschwiegenen – Familiengeschichte erzählen, sei es, weil ein Ereignis journalistisch dokumentiert ist – die Geschichte von der riesigen Lawine –, treten die Metaphern zurück und überlassen der eigentlichen Erzählung das Feld. Ein Roman dieser Machart ist immer auch die Geschichte eines Kampfes. Die Metaphern gehören zum Kampf, für Vescoli sind sie eine Waffe, um zu guter Letzt das benennen zu können, was sich naturgemäß entzieht.
Ein schmales Buch der chilenischen Autorin María José Ferrada, übersetzt von Peter Kultzen, der neben anderen auch Sara Gallardo übersetzt hatte, und tatsächlich sind da ein paar Ähnlichkeiten zwischen Ferradas Plakatwächter und Eisejuaz von Gallardo (Vorlieben des Übersetzers, nichts spricht dagegen, Kultzen versteht etwas von Literatur, in jedem Fall sind mir seine Empfehlungen lieber als das Kommerzspiel von Literaturpreisen und Agenturen, das längst den Markt beherrscht). Ähnlichkeiten, sei es auch nur die Seltsamkeit, die abweichende Sprache und, bei Ferrada, der unübliche Blick, in beiden Fällen durch die Hauptfigur bedingt, ein Indigener im entlegenen Norden Argentiniens, ein Elfjähriger in einem Armenviertel am Rand einer Großstadt, vermutlich Santiago de Chile. Die Perspektive mischt sich in Ferradas Roman allerdings mit der des Erwachsenen, der zurückblickt, es ist der Blick eines Erwachsenen und auch wieder nicht, ein kindlicher Blick und auch wieder nicht, genau das macht den Reiz des Buchs aus, und für solche subtilen Reize hat der Übersetzer ein besonderes Gespür. Die Sätze werden von dem elfjährigen Jungen wörtlich genommen, die Dinge dinglich, animistisch, mit Leben begabt. Das Abnormale schiebt sich tief in Bereiche des Normalen, und auch umgekehrt. Das Außenseitertum des Plakatwächters, dieses höchst seltsamen Erwachsenen, ist ein doppeltes, am Rand der Gesellschaft und am Rand der normal sein wollenden Gesellschaft am Rand der Gesellschaft. Der Plakatwächter als Vogelmensch, ständig betrunken und alles von oben betrachtend und die Dinge wörtlich nehmend wie das Kind, das ihn hoch oben in seinem Verschlag im Plakatgerüst besucht. Und diese Figuren sind einem nahe. Mir jedenfalls. Obwohl ich normalerweise zu den Normalen gehöre.
Vgl. dazu Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte: »Man steigt auf kleinen Leitern hinauf. Am Boden zeigen die Einwohner sich nur selten; sie haben schon alles Notwendige oben und ziehen es vor, nicht herunterzukommen. Nichts von der Stadt berührt den Boden außer diesen langen Flamingobeinen, auf denen sie ruht, und an sonnigen Tagen ein perforierter eckiger Schatten, der sich auf den Blättern abzeichnet. Drei Hypothesen gibt es über die Einwohner von Baucis: dass sie die Erde hassen; dass sie genug Respekt vor ihr haben, um jeden Kontakt mit ihr zu meiden; dass sie die Erde lieben, so wie sie vor ihnen war, und nicht müde werden, sie mit abwärts gerichteten Ferngläsern und Teleskopen zu bewundern, Blatt für Blatt, Stein für Stein, Ameise für Ameise, um fasziniert die eigene Abwesenheit zu betrachten.« Aus so einem Szenario hat Ferrada einen kleinen Roman gemacht. Mit Blick von und nach oben und dementsprechend schwankenden Gefühlen. Liebe, Respekt oder Haß? Bei Ramón, dem Plakatwächter, sind das keine Hypothesen, es mischt sich alles, genau wie im wirklichen Leben. Vielleicht kommt noch ein Gefühl dazu: Gleichgültigkeit. Was nicht dasselbe ist wie Gefühllosigkeit.
Nicht wenige Autor*innen der Generationen X, Y, Z etc. schreiben über nichts, vorsätzlich über nichts. Dieses Nichts schmücken sie mit Wörtern, wie der Bräutigam eine Braut, von deren Charakter er nichts weiß, wie in den vergangenen Zeiten geforderter Jungfräulichkeit. Sie kommen gar nicht auf die Idee, daß sie etwas zu sagen haben könnten. »Deine Plätze immer und wieder aufsuchen, im Wissen, nichts zu finden, aber dieses Stehen vor Wellen, beginnen Stück für Stück aufzuzählen, als könnte dann doch etwas huschen.” Huscht es? Ja, im Irrealis. Hier ein Wörtchen, dort ein Satz.
Letztlich ist es immer ein Spiel von Nichts und Etwas. Etwas sind die Wörter; die Referenz, auf was auch immer, ist das Nichts. In diesem Fahrwasser dachte auch Jacques Lacan, wenn ich mich richtig entsinne, oder besser gesagt: Lacan zog einst diese Fahrwasserschneise. »Le réel, c’est l’impossible.” Man kann das Reale nicht darstellen. Wirklichkeit kommt nicht vor. Wer es darzustellen versucht, haut immer daneben. Schläge ins Wasser. Warum auch nicht? Vorwärts, ihr Impossibilisten! Wortwärts!
Die Infantin, Hauptfigur eines Romans von Helene Adler (Generation Y), ähnelt in manchem dem Plakatwächter. Sie tritt meistens, nicht immer, als Kind auf. Dieses Changieren zwischen Kindlichkeit und Erwachsensein. Nein, Kinderliteratur ist das nicht. Ferrada hingegen hat zahlreiche Kinderbücher geschrieben, es fällt ihr nicht schwer, sich in heutige hiesige Kindlichkeit einzufühlen. Sie nähert die frühe und die spätere Perspektive einander an, überkreuzt sie zuweilen, entfernt sie wieder voneinander. Den Figuren wird die Adlersche Kraftsprache untergeschoben.
»Kritische Heimatliteratur« sagt man dazu immer noch. Heimatlich: Entgegen dem Anschein hat der chaotische Roman eine Struktur, er ist gar nicht so disparatistisch. Hier, der Jahreskreis! Frühling Sommer Herbst und Winter. Grünen, Brennen, Absterben. Weihnachten kommt vor, und ein paar andere schaurige Feste. Ostern, oder nicht, ich weiß es nicht mehr, ein bißchen Disparition darf sein. Episoden und Episödchen. Der Salzburger Christkindlmarkt auf dem Residenzplatz, auf Papas Schultern. Neujahrskonzert im Fernsehen. Hl. 3 Könige. Der Bauernkalender.
Was heißt unter diesen Bedingungen »kritisch«? Wo es doch nur darum geht, Spaß zu haben, und das kann man besser denn je. Kein Grund, angebissen zu sein. Oder gar, sich umzubringen. Oder die Feder für immer aus der Hand zu legen.
© Leopold Federmair