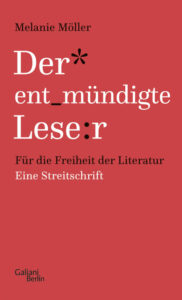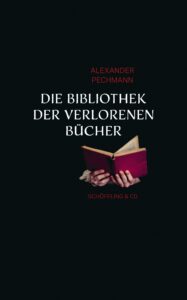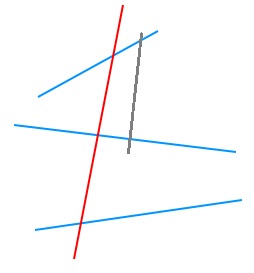Natürlich ist das Cover eine Provokation. Der* ent_mündigte Lese:r steht dort. Drei Symbole der »Gendersprache« – Stern, Unterstrich, Doppelpunkt. Entweder oder. Hier alles auf einmal. »Für die Freiheit der Literatur« lautet der Untertitel. Dem Buch vorangestellt ist ein Auszug aus Kafkas Brief an Oskar Pollak, jene berühmte Stelle, in der er erklärt, wie ein Buch sein soll, nein: sein muss.
Das Genre: »Eine Streitschrift«. Wer jetzt von Melanie Möller eine schäumende Wutrede erwartet, wird enttäuscht. Denn das hat die Autorin nicht nötig. Dabei ist die Marx-Paraphrase zu Beginn vom Gespenst, was in Europa umgeht, ein rhetorischer Einstieg. Möller konstatiert, dass man sich an der Literatur vergeht, wenn man auf »Leserbefindlichkeiten« einiger weniger Rücksicht nimmt. Sie führt Beispiele für erwünschte »Anpassungen« an, die notwendig sein sollen, um inkriminierende Wörter oder gar mehr auszuschalten. Ein Schwerpunkt ist natürlich das sogenannte »N‑Wort«, das inzwischen überall entfernt wird. Möller ist damit nicht einverstanden, zitiert Martin Luther King, fächert die möglichen Gebrauchsformen dieses Wortes auf, wie »neutral, deskriptiv, kritisch, herablassend, aber auch dezidiert selbstbewusst«. Möglichkeiten, die sich nur innerhalb des jeweiligen Textes zeigen, werden durch die Umschreibung und/oder Entfernung vorauseilend und oft genug den Text entstellend getilgt.
Wie also diesen »auf der Arche postkolonialer Kritik durch die Welt« segelnden »ideologischen Blindheiten« begegnen? Möller lehnt begütigende Kompromisse, die den Zeitkontext eines literarischen Werkes entschuldigend heranziehen als zu defensiv ab und plädiert für eine »Loslösung von hergebrachten schwarz/weiß- bzw. links/rechts-Kategorien« wie auch »von einer allzu lauten Selbstfeier der Aufgeklärten (und) Humanisten«. Möllers Aussage ist eindeutig: Die Deutungsmacht liegt einzig beim mündigen Leser, der alle Möglichkeiten bekommen soll, sich sein eigenes, auf Leseerfahrung basierendes Urteil an einem Originaltext zu bilden. Leidenschaft für die Literatur sei »das Gebot der Stunde«. Verblüffend genug ihre Empfehlung, Nietzsches Unzeitgemäße Betrachtungen. Den eher alarmistischen Zeitgenossen möchte sie sich nicht anschließen und lobt differenzierte Auseinandersetzungen wie die von Caroline Fourest (Generation beleidigt), Byung-Chul Han (Palliativgesellschaft) und Svenja Flaßpöhler (Sensibel). Das Vorwort mündet mit einem emphatischen Appell: »…bitte gar keine Kompromisse, keine Änderungen an den Texten, schon gar nicht bei toten Autoren, die sich nicht wehren können. Wer etwas nicht lesen möchte, darf es gerne lassen oder entsprechend kommentieren.« Mündigkeit braucht Freiheit.
Den vollständigen Text »Mehr Licht!« bei Glanz und Elend weiterlesen.