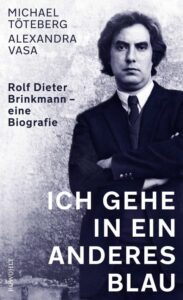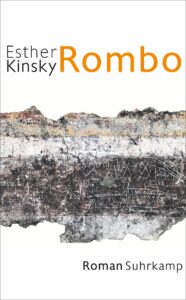Ein Interview mit Leopold Federmair, geführt von Masahiko Tsuchiya ‑2. Teil
Hier Teil 1
Wie stehst du als Essayist zur japanischen Kultur und Gesellschaft? Wie beschreibst du deine Japan-Erfahrungen? Mit Ironie und Witz, nicht wahr?
Ich fürchte, zum Witz habe ich kein großes Talent, aber ganz ohne Ironie kann jemand wie ich weder leben noch schreiben. Ich habe sehr verschiedene Zugänge, aber das betrifft nicht nur Japan, sondern alle »Gegenstände«. In einem Buch wie Die großen und die kleinen Brüder vermische ich bewußt die Genres, von der Reportage bis zur lyrischen Kurzprosa. Der umfangreichste Teil des Buchs sind die Tokyo Fragmente, die ich immer noch fortführe, sie erscheinen regelmäßig, mit von mir gemachten Fotos, im Online-Magazin fixpoetry.com. In diesen Fragmenten erkunde ich mit einem gewissen Maß an Systematik, aber zugleich anarchisch, indem ich mich und die Sprache treiben lasse, die japanische Großstadt. Dabei interessieren mich kleine Alltagsszenen und Orte abseits der touristischen Pfade – obwohl ich auch diese nicht grundsätzlich verschmähe. Es gibt sogar einen roten Erzählfaden in diesen Fragmenten, er wird in erster Linie von einer Bar in Musashikoyama und der dort sich regelmäßig einfindenden dramatis personae gebildet. Im Prinzip sind diese Geschichten nicht fiktional, aber es ist auch Erfundenes dabei. Meine Lieblingsszene darin ist erfunden, auch deren Protagonist.
Andererseits schreibe ich Romane wie Wandlungen des Prinzen Genji, die eng mit meinen realen Erfahrungen verbunden sind, wo aber die Gesamtanlage fiktional ist und auch die darin vorkommenden Figuren von etwaigen Vorbildern in der Wirklichkeit mehr oder minder stark abweichen. Dieser Roman enthält auch eine essayistische Ebene, die wiederum zu großen Teilen aus Nacherzählungen und Kommentaren zum Genji-Monogatari bestehen. Schon der Roman Erinnerung an das, was wir nicht waren spielt aber etwa zur Hälfte in Japan, zur anderen in Argentinien (die dritte Hälfte in Europa). Bei diesem Buch, bisher mein umfangreichstes, interessierte mich besonders die Gegenüberstellung sehr unterschiedlicher Kulturen mit teilweise gegensätzlichen Lebensgewohnheiten wie der argentinischen und der japanischen. Ich lebe gern zwischen solchen Gegensätzen, weiß aber auch aus eigener Erfahrung, daß so eine Existenz großen inneren Druck erzeugen kann. Es gibt Grenzen des Identitätspluralismus.
Wofür interessierst du dich zur Zeit und warum?
Es wird wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende so sein, daß ich eine bestimmte Zahl von Projekten vor mir habe, die ich zu realisieren bestrebt bin. Alles zu schaffen, wird die Zeit nicht reichen. Auch das muß man akzeptieren. Derzeit schreibe ich an einem Roman, der durch ein japanisches fait divers angeregt ist, aber einen imaginären Schauplatz hat. Seit einigen Wochen glaube ich, die richtige Form dafür gefunden zu haben, nachdem ich jahrelang daran herumgedacht und herumprobiert habe. Wie Kenzaburo Oe sagt, die Form ist das Entscheidende. Ein anderes Projekt, in dem ich stecke, ist die Übersetzung eines umfangreichen Lyrikzyklus von Juan Ramón Jiménez, 1916 während seiner Amerikareise entstanden. Und dann habe ich noch eine Idee, die ich besser nicht verrate. Es hat mit der Figur Adolf Hitlers zu tun und ist das erste Mal, daß ich das Gefühl habe, man könnte mir die Idee klauen, wenn ich sie weitererzähle.
Wie schreibst du Romane oder Erzählungen? Bis deine literarische Form ausgereift ist und dich selbst überzeugt?
Weiterlesen ...