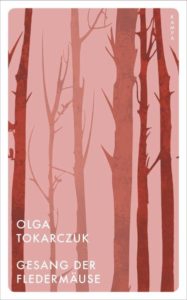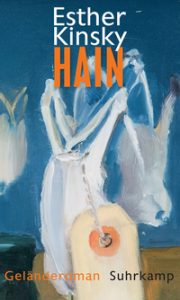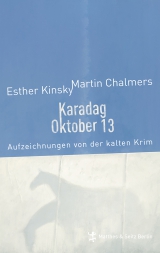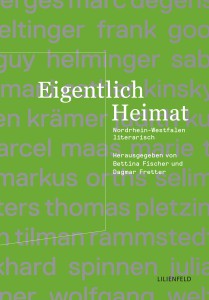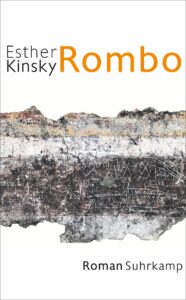
Vor einem Jahr veröffentlichte Esther Kinsky den polyphonen Roman Rombo, der von den verheerenden Erdbeben im Mai und September im italienischen Friaul, nahe dem damaligen Jugoslawien und heutigen Slowenien, erzählt. Der Titel erklärt sich durch ein Zitat von 1838, in dem »Rombo« als Bezeichnung für das Geräusch angegeben wird, welches sich kurz vor einem Erdbeben »aus dem rollenden Tone einer aneinander hängenden Reihe von kleinen Explosionen« einstellt. Bemerkenswert an Kinskys Roman ist der Dualismus intermittierender Landschafts- und Naturerzählungen einerseits und den Figurenreden von sieben Protagonisten andererseits (fünf Frauen und zwei Männer), die ihr Schicksal während und nach der Katastrophe und, gegen Ende, auch Kindheitserinnerungen berichteten und ihr Leben überblickten.
Dabei bleibt die Sprache in den zum Teil betörenden Landschaftserzählungen streng bei den Dingen, die sich losgelöst von menschlichen Wahrnehmungen und Kategorien von selber erzählen und dabei einen konzisen geomorphologisch-botanischen Überblick auffächern, der bis hinein in die menschlichen lokale Natur- und Sagenmystik reicht. Zuweilen schimmert eine Schicksalsmetaphorik hervor, etwa wenn vom »Kalksteinboden« als dem »Boden der Armut« die Rede ist. Divergierend dazu die Erinnerungen der Dorfbewohner (deren Schilderungen sich teilweise überschneiden, weil sie alle aus der Region um Venzone stammen), die sich im Laufe des Romans zu familiären Auswanderer‑, Dableiber- und Verrücktwerder-Geschichten ausweiten und die einstigen und zukünftigen Hoffnungen der Protagonisten reflektieren. Nachträglich ist es empfehlenswert, diese zwei Bücher – Natur- und Märchenwelt und Erinnerungen – separat zu lesen.