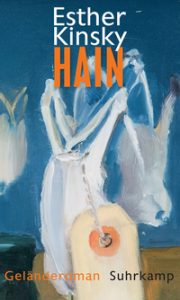
»Geländeroman« nennt Esther Kinsky ihren neuen Roman »Hain«. Und natürlich horcht der Kinsky-Leser auf: Wird es so etwas wie »Am Fluß« vor drei Jahren, als eine Ich-Erzählerin ihren Aufenthalt in der Londoner Peripherie nicht nur erzählte, sondern in diese Landschaft eintauchte, ja einsank. Dabei handelte es sich nicht um im landläufigen Sinn schöne, sondern eher das, was man »Un-Orte« nennen könnte. Orte, die hässlich und eben doch auf eine besondere Weise fast idyllisch sind, weil das wahrnehmende Erzählen sie transzendiert. Unterlegt wurden diese Evokationen mit Erinnerungen an die Kindheit. Beides findet man auch in »Hain«. Abermals quartiert sich die Ich-Erzählerin in eine periphere Landschaft ein. Diesmal ist es die kleine Gemeinde Olevano Romano in Italien, östlich von Rom, ein, wie es heißt, »lebloses Dorf«. Sie bewohnt ein Haus »auf einer Anhöhe«. »M.«, der Lebenspartner der Erzählerin, ist zwei Monate und ein Tag zuvor beerdigt worden. »M.« ist Martin Chambers, der im Oktober 2014 starb. Kinsky-Leser kennen das Krim-Tagebuch der beiden, welches Kinsky alleine beenden musste.
Es ist also Anfang 2015. Die Erzählerin (die ich trotz der fast erdrückenden Übereinstimmungen nicht Esther Kinsky nennen möchte) beginnt zu erzählen, von ihrer Umgebung, dem Friedhof, auf den sie freie Sicht hat, dem Marktplatz, den einsamen afrikanischen Händlern, der Metzgerei. Eine Gleichförmigkeit, ein Einswerden mit der Landschaft mag sich zunächst nicht einstellen: »Jeden Morgen war mir, als müsste ich alles neu lernen.« Das beginnt mit dem Wasserkochen und setzt sich im Sehen fort. Über die sukzessive topographische Einvernahme wird das Leben neu konstituiert: »Ich schaute auf das Dorf und auf die Ebene, die sich bis hin zu der Kette schlummernder Vulkanberge erstreckte, hinter denen ich mir die Küste dachte, obwohl ich wusste, dass sie weiter entfernt war. Die Ausdehnung der Ebene war eine optische Täuschung, denn ich hatte selbst erlebt, dass vor Valmontone ein kleiner Hügelrücken la, doch sah ich dieses flache Geländer, in dem zwischen Gehölzen und Hainen kleine Dörfer und Gehöfte, Werkstätten und Supermärkte und eine der Olivenbaumkrankheit wegen derzeit geschlossene Ölmühle lagen, gerne als ein zusammenhängendes Becken an, eine Art ehemaligen See, dessen Wasser sich werweißwann und werweißwohin davongemacht hatte…«
Es sind mäandernde Sätze, die scheinbar kein Ende kennen, deren Rhythmus man beim Lesen treffen muss, um sich nicht zu verzetteln. Sätze, die zuweilen zwischen einer Makrowelt der Landschaft, und der Mikrowelt wie sie sich beispielsweise auf dem Boden des Friedhofs zeigt, changieren. Wie die Erzählerin so gerät auch der Leser immer mehr in den Sog dieses Kosmos, changierend zwischen Katzen- und Hunde‑, Markt‑, Sturm- und Jagdtagen in dieser Landschaft und deren Veränderungen vom Winter hin zum Frühling. Mitunter stehen Wahrnehmungen und Assoziationen direkt nebeneinander, durchdringen sich gegenseitig und es sind diese Momente des stillen Einverständnisses mit sich und der Welt, die die kleinen Höhepunkte des Buches bilden. Fast störend sind da die gelegentlichen Ausflüge etwa nach Trastevere oder, weiter entfernt von Rom, nach Paliano, diese Suchen nach der »Möglichkeit einer Landschaft« und man ertappt sich dabei die Rückkehr zum andersschönen Olevano Romano herbeizusehnen.
Im Mittelteil schieben sich die Erinnerungen an den kosmopolitischen Vater, einem Kulturwissenschaftler, in den Fokus. Hier, in dieser Phase, ist es das Gelände der Kindheit, welches ausgebreitet, evoziert, wird. Und die Trauermelancholie, die das Buch subkutan durch das Gedenken an den verstorbenen Geliebten durchzog, wird nun um die Vatererzählungen ergänzt. Kinsky hatte beobachtet, dass es in rumänischen Kirchen zwei separate Gehäuse für Kerzenopfer gibt: auf der linken Seite für die Lebenden (viǐ), auf der rechten für die Toten (morțǐ). Sie versucht, diese Trennung aufzuheben, die Toten durch die Erzählung für eine kurze Zeit ins Reich der Lebenden zu überführen.
Dabei changiert die Sicht auf den Vater von zärtlich-distanziertem Unverständnis bis zu einer Art von stillem Stolz. Eindringlich und dennoch nicht sentimental das Erinnern der letzten Begegnung mit dem Vater in Triest. Das Sich-Anschweigen, des Vaters Beflissenheit als Reiseführer (ein neuer Beruf für ihn; eher Berufung). Schließlich die Beerdigung ein Jahr später.
Im dritten Teil des Buches begibt sich die Erzählerin erneut auf eine Reise, sucht weiter die Orte der Kindheitsreisen auf und auch jene, an denen man damals vorbeigefahren ist oder die man dann doch liegen ließ. Vor allem geht es durch die Bassa Padana, einer Landschaft, die ihr zuweilen wie aus Satzzeichen geformt erscheint. Sie besucht Ferrara, die Totenstadt Spina, schließlich ein Mosaik in Ravenna, von dem ihr der Vater erzählt hatte. Sie sieht Flamingos, verirrt sich zuweilen, entdeckt »eine alte Ordnung der Welt«, sucht das Blau Fra Angelicos, jenes Blau, das der Vater so geliebt hatte, besucht die Salinen von Comacchio und komplettiert ihre Kindheitserinnerungen, derart »als sollte ich eine Aufgabe erfüllen«. Die Aufzeichnungen zeigen sich als existentielle Notwendigkeit: »Etwas Aufgetragenes erledigen. Orte aufsuchen, Gelände begehen, mich an den dünnen Fadenspuren entlangtasten, die sich zwischen meinen Erinnerungen und Bildern, Orten, Namen spannten.«
Der Leser kann der Protagonistin bei ihren Ausflügen im Internet folgen, so präzise zuweilen die Erläuterungen. Aber es ist besser, er lässt es und überlässt sich stattdessen dem Strom des Erzählens, entflieht dem lockenden Naturalismus zu Gunsten der kunstvoll gesetzten Sprache, die weder lakonisch noch pathetisch daherkommt, sondern den Dingen, den Gefühlen, dem Leben ihren Platz einräumt und kunstvoll Topographien mit den eigenen Befindlichkeiten zusammenführt. Dass es sich dabei nicht bloß um Literatur-Literatur handelt, sondern um ein episches und gleichzeitig elegisches Kunstwerk, ist die große Könnerschaft Esther Kinskys.
