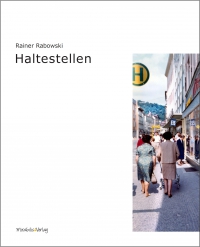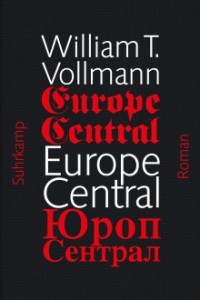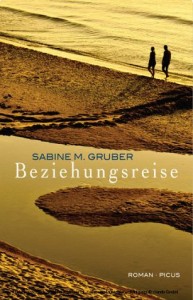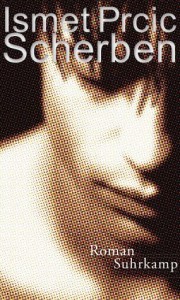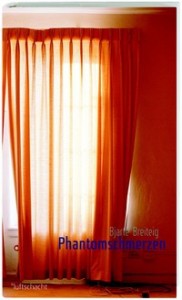
Vor knapp drei Jahren publizierte der österreichische Luftschacht-Verlag sieben novellenartige Erzählungen des 1974 geborenen Norwegers Bjarte Breiteig unter dem Titel »Von nun an«, die 2006 in seinem Heimatland erschienen waren. Es sind zum Teil surreale, im besten Sinne »seltsame«, oft verrätselte und sich für den Leser kaum endgültig erschließende Erzählungen, die ungeachtet dieser vielleicht eher abschreckenden Attribute ihren eigenen Zauber und zuweilen einen starken Sog erzeugen. Jetzt legt der Verlag mit dem Band »Phantomschmerzen« nach. Hier finden sich auf knapp 130 Seiten 15 Erzählungen.
Was sofort zum Vergleich auffällt: Die Qualität der einzelnen Erzählungen differiert stärker als in »Von nun an«. Einige spielen mal mehr, mal weniger offen mit mystischen Elementen, die meist dezent hineinappliziert sind und gelegentlich einen Kontrast zur erzählten Geschichte bilden. So wird zum Beispiel in »Der Wind in den Wänden« Gerbrand-Bakker-gemäss der Tod eines doppelköpfigen Kalbes auf einem Bauernhof, das ein nicht näher beschriebener Junge alleine zu betreuen hat, erzählt. Währenddessen ist sein Vater bei der scheinbar schwerkranken Mutter im Hospital. Das Kälbchen kommt als Totgeburt auf die Welt und wird vom Jungen mit einiger Kraftanstrengung begraben. Als der Vater später eintrifft, wird unausgesprochen der Tod der Mutter als sozusagen paralleles Ereignis suggeriert. Noch einmal, in »Kleine Brüder«, spielt eine nicht näher bezeichnete Krankheit einer Mutter eine Rolle, während Arnstein, ein kleiner Junge und offensichtlich ihr Sohn, im Krankenhaus mit einem kleinen Mädchen spielt und nur sehr diffus ahnt, weswegen er in diesem Gebäude ist und was sich dort ereignet.