»…schöpfe Kraft aus seinem Leiden, und lass das Büchlein deinen Freund sein,
wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden kannst.«
(Johann Wolfgang Goethe, »Die Leiden des jungen Werther«)
Der weihevolle Ton und die 785 Fuß- bzw. Endnoten
Wie immer, wenn es sich um ein literarisches Erzeugnis um den Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs handelt, in dem mehr oder weniger geschickt in einem postmodernen Varieté-Theater fiktive Figuren mit historischen interagieren, überschlägt sich die deutsche Literaturkritik mit Lob. »Überwältigend«, »literarisches Highlight des Jahres« und natürlich auch wieder die obligatorische Zuschreibung »Meisterwerk« – so lauten die Hymnen auf diesen Roman und ich frage mich unwillkürlich, wie viele dieser Preissänger wohl das Buch (inklusive der Anmerkungen; hierzu s. u.) überhaupt zur Gänze gelesen haben, aber dafür gibt es schließlich die vom Lektoratsvolontariat verfertigten Waschzettel und Pressetexte.
Derweil wird also der weihevolle Ton für dieses unausgegorene, sicht- bzw. lesbar ambitionierte, teils melodramatische und am Ende gescheiterte Buch angestimmt. Es sei, so betont Vollmann mehrmals, ein Roman. Eine Genreklassifizierung, die notwendig ist, da der Autor einen Mockumentary-Brei anrührt, der dann in einem umfangreichen Apparat mit 785 Endnoten (ohne die Sternchen-Fußnoten im eigentlichen Text) brav all die Hinzufügungen, Verbiegungen, Unterstellungen und erfundenen Zitate auflöst und klarstellt. Die Desillusionierung des gerade Gelesenen wird also beim gleichzeitigen Konsum der Endnoten sofort wirksam; es hält länger, wenn man sich die Anmerkungslektüre für den Schluss aufhebt. Dann wird man auch nicht das zweite Lesezeichen vermissen, was notwendig gewesen wäre, aber man muss Suhrkamp schon für das eine dankbar sein.
Das vielstimmige Lob hat mich dann doch überrascht, weil ich die zum Teil lächerlichen wie dummdreisten Vorwürfe gegen Nicholson Bakers »Menschenrauch« noch in Erinnerung hatte. Baker hatte Dokumente kommentierend miteinander montiert, die die manichäische Sichtweise des Zweiten Weltkrieges (zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich) in ihrer bisherigen Form ein bisschen gegen den Strich bürstete. So erschien Churchill als eifernder Bellizist. Und Roosevelt, der die Hilferufe jüdischer Organisationen für eine höhere Einwanderungsquote in die USA ignorierte, wird zum überpeinlichen Bürokraten, dem eigentlich schon der jüdische Anteil an den amerikanischen Universitäten etwas zu hoch war. Gandhi geriet als Mischung aus Idealist und Hitler-Versteher, der Hitlerismus und »Churchillismus« auf eine Stufe stellte. Prompt wurde Baker vorgeworfen, dass er Ursache und Wirkung vertauscht haben sollte. Aber darum ging es ihm gar nicht; die Verbrechen der Nazis hatte Baker mit keinem Wort wie es so schön heißt »relativiert«. Er hatte sich nur erlaubt, die Herren mit den vermeintlich weißen Westen mit ihren Flecken zu zeigen. Aber das genügte, Bakers Buch zu diskreditieren. (Sein Fehler war dann, dass er unsauber gearbeitet hatte und einigen Verschwörungstheorien zu offensichtlich zusprach.)
Moralische Gleichsetzung
Und nun dieses Buch hier. Aber vielleicht ist es ja gar nicht aufgefallen: Vollmann erwähnt in seinem Nachwort ausdrücklich die »moralische Gleichsetzung von Stalinismus und Hitlertum« als legitimes Vorgehen. Damit »verstößt« er gegen die in Deutschland verinnerlichte Übereinkunft, dass die Nazi-Verbrechen singulär gewesen und somit historisch unvergleichbar seien. Tatsächlich hat man in der seriösen Geschichtswissenschaft schon längst diesen kruden, primär deutschen Geschichts-Feuilletonismus hinter sich gelassen, wie auch Jörg Baberowkis Ausführungen zeigen. Nazismus und Stalinismus können durchaus miteinander verglichen werden, ohne dass man sich als Revanchist oder gar Rechtsradikaler bezeichnen lassen muss – wenn der Vergleich neben den unleugbaren Gemeinsamkeiten (Mord bleibt Mord) auch die Differenzen hervorhebt.
Vollmanns Buch manövriert immer wieder zwischen Nazi- und Stalin-Terror hin und her. Am eindringlichsten gelingt dies in den Kapiteln um Wlassow und Paulus: dem hoch dekorierten russischen General, der sich den Nazis zuwandte und für sie eine Söldner-Armee aufbauen sollte (die bei den Oberen auf große Vorbehalte stieß) und dem deutschen Feldmarschall, der sich ein einziges Mal einem Führerbefehl widersetzte – und zwar als es um sein jämmerliches Leben ging – und sich gefangen nehmen ließ und dann, viel später, in der DDR, Vorträge im Sinne der SED-Doktrin hielt. Wlassow ließ sich willig in den Propagandaapparat der Nazis einbinden; seine Zweifel wurden mit Katyn und Lügen besänftigt. Für ihn war nach seiner Erfahrung im Krieg Hitler – unvorstellbar für uns – »das kleinere Übel«. Er unterzeichnete Pamphlete, die über russischen Stellungen abgeworfen wurden und zur Desertion aufforderten (welches Schicksal diese Gefangenen genommen hätten, war ihm nicht klar). Dafür internierte man zunächst seine Frau und richtete ihn 1946 in der UdSSR als Verräter hin. Paulus erging es besser, er änderte – nach Vollmann – nur dauerhaft seine Gesichtsfarbe und starb friedlich 1957. Beide Protagonisten wechselten die Seiten, beiden attestiert Vollmann jeweils große Vorbehalte und Gewissensbisse (sie ließen ihre Familien zurück). Sie wurden nicht glücklich damit, weil der Zweifel, dem sie zu entkommen hofften, an ihnen nagte.
Ein großes Verdienst dieses Buches: Es wird mit Verve mit der Kategorisierung von »richtig« und »falsch« aufgeräumt. Das unendlich strapazierte Adorno-Wort vom richtigen Leben, welches im falschen nicht führbar sein soll (es bezog sich ursprünglich auf eine Inneneinrichtungsfrage), wird hinweggefegt und klargestellt: Es geht nicht um ein »richtiges Leben«, welches professoraler Gnade genügt, sondern es geht nur um das krude Über-Leben – und dies irgendwie. Wer damals in Deutschland oder der UdSSR lebte, war per se immer auf einer falschen Seite – entweder qua Entscheidung oder, was wahrscheinlicher war, qua Geburt. Alles was man tat, war ein Sich-Einlassen auf das Verbrecherische, was man nicht ändern konnte. Alles war Arrangement, weil man am Leben hing. Es gab keine Möglichkeit, diesem Fatum zu entgehen – man musste sich verhalten. Und da jeder Weg kontaminiert und auch ein (vermeintlicher) Ausweg, fast allen unmöglich, war ein Irrweg.
Schostakowitsch als sowjetischer Leverkühn?
Diese These durchzieht das Buch; die Belege werden an allen möglichen Stellen in den Text hineingepflastert. Der Prototyp des angepassten, ständig zwischen Orden und Arbeitslager lavierenden Intellektuellen ist für Vollmann Dimitri Schostakowitsch. Die Faszination für diesen Komponisten und seinem Werk ist nahezu grenzenlos. Über hunderte von Seiten dichtet Vollmann ihm eine lebenslange, quälende, verzehrende Liebelei zur (tatsächlich nur kurzfristigen) Geliebten Elena Konstantinowskaja an, die ähnlich quälend und in einem Schostakowitsch offensichtlich eigenen, stotternden Satzduktus (abgehackte Sätze; persönliche Anreden) wie transkribiert erzählt und ausgebreitet wird. Geheiratet hatte Schostakowitsch schließlich Nina. Konstantinowskaja, die zeitlebens Imaginierte, heiratete (zunächst) den sowjetischen Dokumentar- und Propagandafilmer Roman Karmen (der als eine Art russischer Leni Riefenstahl präsentiert wird), was dazu führt, dass auch dessen Leben und seine linientreuen Filme ausführlich vorgestellt werden (im Gegensatz zu Schostakowitsch kommt der zielsicher balancierende Karmen niemals in Schwierigkeiten). Vollmann schreibt ihnen sogar eine ménage-à-trois zu, was er aber auf Seite 1021 als Fiktion klarstellt (Vollmann stellt – s. o. – fast alles klar, wobei man sich fragt, warum es dann vorher so zum Teil durchaus filigran collagiert).
Immer wieder werden Schostakowitschs Kompositionen erzählt, beschrieben, im Kontext mit Sex, Krieg, Belagerung und Stalinismus gesetzt. Da wird in Opus 40 die »Schaukelpferd-Kopulation« (inklusive »fröhliche[m] Samenerguß«) eingebaut, blitzen in Opus 110 »zwischen den Wolken…atemberaubend chromatische Fugen« auf und nicht zu vergessen die Inspiration durch das »Timbre [der] Seufzer« Elenas (die mit fortschreitender Zeit und Erinnerung immer euphorischer werden), deren Klitoris »elektrisch geladen« ist und das wird natürlich auch sofort ins Musikalische übersetzt, denn es »gab nichts, das sich nicht in Musik verwandeln ließ!« Aus den abgeworfenen Bomben kann man »unter idealen Bedingungen alle acht Stufen der diatonischen Tonleiter ausdrücken«. Und so komponiert Schostakowitsch entweder aus dem Hölleninferno von Leningrad oder aus Elenas Schoss und die Noten, auf Papier »zu Akkorden oder Takten verbunden« sahen »wie Insekten« aus, »die im Drahtverhau zappelten« und »die 5. Sinfonie wird mit Horden aus perfide sich sträubenden Noten mit Fliegenbeinen und an den Stacheldraht der Notenblätter geknüpften Akkorden enden« während Opus 110 »kreischen [wird ]wie Patienten in einem brennenden Krankenhaus«. Wer sich über Ernst Jüngers Stahlgewitter-Ästhetik der 1920er Jahre aufregt, fände hier ein neues Forschungsfeld.
Dennoch: Es sind Bilder und Interpretationsstürme, die erstaunen, teilweise entzücken – aber auch manieristisch-kunstwollend daherkommen. Und es ist schon ziemlich deutlich, dass Vollmann durchaus an die Geschichte über Adrian Leverkühn anknüpfen möchte. Aber Schostakowitsch hatte keinen Pakt mit dem Teufel geschlossen, er musste mit den Exegeten des wahren Sozialismus kämpfen: In unplanbarer Willkür fällt er regelmäßig-unregelmäßig in Ungnade und muss sich dann rechtfertigen ob seines »Formalismus« (was das ist, bestimmen immer die anderen), entschuldigt sich dann mit äußerster, heutzutage peinlich anmutender Servilität (ohne jedoch jemals eine Komposition zu verändern) – und macht dann für sich einfach weiter. Stalinorden und die Sorge von der Geheimpolizei abgeholt zu werden wechseln sich ab (das Ende des Krieges macht es noch schlimmer und auch der Tod Stalins bringt nur zeitweise Erleichterung) und Schostakowitsch erträumt zuweilen schon die Klopfgeräusche der Geheimpolizei an seiner Tür, die er schon in eine Melodienfolge umkomponiert und wird dann in der Chrustschow-Ära doch noch Mitglied der Partei, deren Repräsentanten er eigentlich verabscheut (vielleicht doch ein sowjetischer Dr. Faustus?).
Vollmanns Programmatik für dieses Buch wird gegen Ende griffig bilanziert: »Und Schostakowitsch, der endlich in die negativen Räume unter den schwarzen Tasten des Klaviers eintritt, weitet seine Front aus, weit über die Musik hinaus, bis hinein in eine vollkommene Hölle, in der sein Leben, die Entkulakisierung und das Unternehmen Barbarossa eins werden«. Diese vollkommene Hölle zu Literatur verarbeitet heißt dann »Europe Central«. Dabei: Nichts gegen die weiträumigen, vielleicht (lever-)kühnen Assoziationen zwischen Musik und Literatur und/oder Musik und Krieg. Auch wenn dann manches recht abgegriffen und aus dem Kontext des Historischen oder Privaten abgeleitet erscheint. Dennoch fügt Vollmann der Schostakowitsch-Interpretation ja vielleicht Neues hinzu. Aber die plüschig-parfümierten, melodramatischen Liebes-Inkonvenienzen des Komponisten sind mit der Zeit ziemlich unerträgliches Lesefutter. Überhaupt die Sprache in diesem Roman: In den einzelnen Kapiteln, die oft genug als Antipoden Deutsches Reich vs UdSSR zusammengeklammert werden, erzählen jeweils glühende Anhänger der vorherrschenden Ideologie. Bei den Geschichten aus der Sowjetunion ist dies oft der (fiktive?) Genosse Alexandrow; bei Deutschland ein schwieriger zu benennender Nazi- vielleicht SS-Mann. Diese Sprachspiele im jeweiligen Verbrecher-Duktus gelingen zumeist als Verstärker der (von Vollmann durchaus kalkulierten) Leserempörung; aber allzu oft verfallen die Erzähler in einen nicht nur unpassenden (das wäre ja noch erträglich), sondern stark an der Gegenwart orientierten Zynismus.
Und dann die peinlichen bis unfreiwillig komischen Metaphern, die sich da finden lassen. Ein Gewehr ist ein »Phallus aus Stahl«, ein Leutnant an einem Eingang wird zum »Türhüter« (Literatur! Kafka!) und das »gefrorene« Blut der russischen Widerstandskämpferin Soja, »dunkler als Stahl, schärfte die erhobenen Säbel der Kosaken«. Im Zug nach Warschau entdeckt ein SS-Mann ein lesendes, polnisches Mädchen, deren »die nackte Haut an« (sic!) »seiner Kehle« »so vollkommen [war] wie eine politische Idee« (»Es mochte ein Freudenmädchen sein«, heißt es dann lapidar). Elenas Haar war einmal »so dunkel wie das Lampenkabel vor der blassen Zeltwand«. Eine Nacht war so schwarz »wie die Uniform eines SS-Mannes« (geradezu dümmlich, wie Vollmann im Buch »SS« immer als blitzende »S« schreibt und auch sonst einige typographische Spielereien glaubt nötig zu haben). Und Schostakowitschs Leben wurde in den 1960er Jahren »so ruhig wie das abebbende Geräusch eines deutschen Bombers, der eben eine Last abgeworfen hat«. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Kurt Gerstein und Hilde Benjamin
Zugegeben, es geht in diesem Buch nicht nur um Schostakowitsch. Historische Persönlichkeiten aus Deutschland und der Sowjetunion geben sich die Klinke in die Hand. Es gibt Ausführliches über die Lenin-Attentäterin Fanny Kaplan, die deutsche Künstlerin Käthe Kollwitz, die Dichterin Anna Achmatowa (die Achmatowa zieht sich jedoch – wie so manch anderes Motiv immer wieder durch die einzelnen Kapitel). Nebenrollen (d. h. gelegentliche Erwähnungen unterschiedlichster Art) gibt es zahlreiche; beispielsweise Erich von Manstein, Lisca Malbran [eigentlich: Marlis Carmen Hoffmann], eine deutsche Schauspielern [1925–1946], so etwas wie der Soldatenschwarm damals) oder Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski (zu allen enthält sich Vollmann eines dezidierten Urteilsspruchs). Diese Nebenfiguren erzeugen durch ihre kontinuierliche Erwähnung im Roman so etwas wie einen (oberflächlichen) Zusammenhalt.
Aber dann gibt es einige wenige Kapitel im Buch, die von einem hochmoralischen Erzählpathos getragen werden. Da wird dann der SS-Mann Kurt Gerstein (der »Spion Gottes« – in Anspielung auf Gersteins christliches Weltbild), der unter anderem die für Auschwitz bestimmte Blausäure vergrub statt zu transportieren und nach dem Krieg seine detaillierten Aufzeichnungen über die Gräuel von Wehrmacht und SS mit wenig Erfolg den Alliierten anbot (die später so genannten »Gerstein-Berichte« wurden erst nach seinem Freitod 1946 ernst genommen), zu einem Helden mit einer gewissen Portion Schwejkscher Verstellungsklugkeit. Als ginge es darum mit ein paar Eseleien Befehle mit taktischem Falschverstehen zu konterkarieren. Saul Friedländer machte bereits 1968 auf Gerstein aufmerksam (in vier Teilen im »Spiegel«: I, II, III, und IV) und Vollmann wischt die in der Forschung artikulierten Ambivalenzen in der Beurteilung nonchalant weg: Indem Gerstein vordergründig ein Rädchen im Getriebe des Nazistaates war und dennoch auch Sand hineinstreute, verhält er sich widerständig (freilich ohne sich über Gebühr zu gefährden). Da macht es für Vollmann nichts aus, dass seine Aktionen nur zeitaufschiebende Wirkung hatten und niemals etwas verhinderten. »Saubere Hände« lautet die Überschrift zum Gerstein-Kapitel, das zwischenzeitlich bei allem Furor Elemente von Kitsch aufweist (was dafür sprechen könnte, dass Vollmann der Gerstein-Geschichte nicht so recht traut).
150 Seiten später nimmt sich Vollmann im Kapitel »Die Rote Guillotine« mit ähnlichem Impetus den so oft gehätschelten und in seinen häufig verbrecherischen Ausmaßen kleingeschriebenen linken Idealismus vor. Es geht um Hilde Benjamin, die im Nachkriegs-Ostdeutschland die maßgebliche und in mehrfachem Wortsinn treibende Kraft für drakonische Strafen (sechs Jahre Haft für den Verkauf von Eiern) bis hin zu Todesurteilen war (»Tod, Tod, Tod«). Immerhin schaffte sie es 1959 auf dem Titel des »Spiegel«. Den britischen Historiker Richard J. Evans zitiert Vollmann mit der Aussage, Benjamin sei »des Massenmordes absolut fähig« gewesen. Es ist eines der stärksten Kapitel des Buches, das sich zum großen Teil aus Aufzeichnungen aus Benjamins Stasi-Akte speist. Schließlich bekommt man auch einen feinen Einblick über den virulenten kommunistischen Antisemitismus jener Jahre: die Heroine Benjamin erbleicht bei der Aussage eines Todgeweihten in einem Prozess, sie sei eine Jüdin. Sie erbleicht, weil sie sich um ihre Reputation innerhalb der Funktionärskaste fürchtet. Vollmann kennt kein Pardon und stellt den SS-Mann moralisch weit über die Anklägerin und Richterin gegen den vermeintlichen Faschismus in der (kommenden) DDR.
Und wie hält er es mit dem Literarischen?
Schwach geraten hingegen die Versuche Szenen des Krieges als eine Mischung aus Expressionismus, Edda und Quentin Tarantino als archaisch-wildes Gewaltepos zu erzählen. Etwa wenn eine Figur phantasierend durch die sowjetische Steppe taumelt. Oder der Eiserne Vorhang als wachsweiche Grenze eines spionageaufreibenden Landes gezeichnet wird. Wobei diese Form der Kritik nicht gegen eine polyphone, ja vielleicht sogar kakophonische Komposition zu verstehen ist, wie es sie beispielsweise im »Echolot«-Projekt von Walter Kempowski gab, der sich jeglichen Kommentars enthielt und ausschließlich über das Arrangement der dokumentarischen Zeitzeugnisse eine sanfte Steuerung vornahm. Hier zählte das Ganze mehr als die Einzelteile. Die Belagerung Leningrads bildet bei Kempowski einer der Schwerpunkte in »Barbarossa ’41« und die Schlacht um Stalingrad kommt im vierbändigen »Januar und Februar 1943« multiperspektivisch vor (und eben nicht nur aus Paulus’ Sicht). Wo der Erkenntnisgrad größer ist – Kempowski oder Vollmann – scheint eindeutig.
Aber Vollmann erhebt ja den Anspruch der Literarizität (was nicht bedeutet, dass Kempowskis Projekt aliterarisch ist). Gelingt ihm dies oder wirkt dieses Buch nur aufgrund seines monomanischen Anspruchs und der Ehrfurcht vor dieser Herkulesaufgabe? Tatsächlich wechseln lange, zum Teil öde Stellen um, mit und über Schostakowitsch mit moralischen, historisierenden Kapiteln und einem verunglückten Expressionismus ab. Das Verfahren ist klar: Es soll eine Simultanität suggeriert werden – das Banale mit dem Künstlerischen; das Archaische kontrastiert mit dem Idealistischen. Hierfür braucht er Schostakowitsch – er wird zur Projektionsfläche. Aber dies genügt nicht. Vollmann wird zum Opfer seiner Konstruktion, weil er dann doch zu viel will: Natürlich müssen auch noch die Nibelungen mit hinein (wegen Wagner). Und natürlich müssen in derb-ironisierendem Ton die Hauptprotagonisten mit allerlei »coolen« Attributen versehen werden. Bis zum Abwinken wird Hitler als »Schlafwandler« bezeichnet, während es etwas dauert, bis Stalin dann als das »Schwein« herausgearbeitet wird. Da macht es sich Vollmann dann – im Gegensatz zu anderen Abschnitten im Buch – zu einfach.
Mag sein, dass man amerikanische College-Lehrer, National-Book-Award-Jurys und deutsche Literaturbetriebssklaven mit diesem wuchtigen Konvolut beeindrucken kann. Und vielleicht muss man als Deutscher einem solchen Buch mit einer gewissen Ehrfurcht begegnen. Sei’s drum: Für den auch nur halbgebildeten europäischen Leser, der sich mit Geschichte und der Literatur um diese Geschichte herum einigermaßen auskennt, wird à la longue zu wenig geboten. Womöglich überzeugt der Roman als nonkonformistisches Gesinnungstheater. Aber das Literarische? Wenn im vorletzen Kapitel Schostakowitschs Leben zähflüssig Jahr für Jahr abgespult wird, hat man es schon aufgegeben; einzig die Pflicht hält einem bei der Lektüre. Das liegt nicht per se am Autor – Vollmann hat mit »Hobo Blues« bewiesen, dass er episch erzählen kann. Das letzte, kurze Kapitel (»Die weißen Nächte von Leningrad«) ist eine Art synästhetischer Farbenlehre, die man vor lauter Erschöpfung mehrmals lesen muss, um dann immer noch nichts zu verstehen (was zweifellos am Leser liegt). Das Schlimmste, was mir während der Lektüre dieses Buches passiert ist: Ich sehnte mich manchmal nach dem unsäglichen Machwerk Jonathan Littells zurück, weil es trotz seiner kruden Mischung aus verrohenden Albernheiten und Schund wenigstens den Impuls des Widerspruchs anstachelte. »Europe Central« möchte man nicht einmal verreißen.
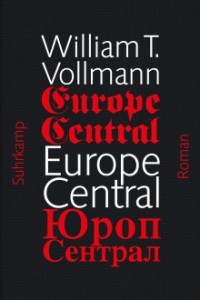
Wahrscheinlich ist Richard J. Evans gemeint, oder?
So ist es. Wird korrigiert. Danke.