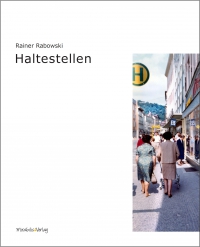
Dabei geht es Rabowski allerdings weder um den Versuch küchenpsychologischer Persönlichkeitsdiagnosen der Anderen noch wird von der Warte einer wie auch immer empfundenen Erhabenheit heraus auf die Welt geblickt. Das sanfte Seelenerkunden, welches in der Regel nur ein genaues Hinschauen und Beobachten ist, wird zumeist nur als Ausgangspunkt für eine Selbstpsychologisierung genommen, die durchaus – und hier liegt der entscheidende Mehrwert beispielsweise zur Innerlichkeitsprosa der 1970er Jahre aber auch dem Gewimmer so mancher SchreibschulabsolventInnen heute – auf Erkenntnisgewinn über die Welt im Allgemeinen zielt. Rabowski fügt dem »empirischen Kreislauf« von Deduktion und Induktion die Selbstreflexion hinzu. Und diese fast unablässig forcierte Selbstreflexion unterscheidet ihn dann deutlich von Autoren, die ihre Figuren nicht in den Abgrund der Tiefe und das »Schimmern der Schlangenhaut« (Dieter Wellershoff) wahrnehmen und stattdessen eher aus (ironischer) Distanz erzählen lassen.
Rabowski ist da mittendrin – und doch immer auch ein bisschen abseits stehend, seiner Widersprüchlichkeiten (bzw. die seiner Figuren) bewusst. Das gilt auch für den schmalen, aber anspruchsvollen Band »Haltestellen«, in dem er seinen Erzählduktus beibehält, aber eine wenn auch großzügige, dafür aber durchgängig präsente, fast romanartige Klammer seinen Geschichten beifügt. Selbst in den Gedichten wird immer wieder das Haltestellenmotiv akzentuiert. Und zur Ergänzung dieses Bändchens wurden noch Fotos in die Texte gesetzt, die als suggestive Stimmungsverstärker kongenial »funktionieren«.
Haltestellen werden zu Platzhaltern im Leben heißt es einmal und dann, etwas später fast programmatisch: Eine Haltestelle, an der man wartet, um zu einem anderen als dem andauernd ungenügenden eigenen, zu einem tatsächlich nächsten Leben aufzubrechen (»Haltestellen I«). Und einmal an einer solchen Haltestelle angekommen braucht man nur zu warten, den entscheidenden Moment abzupassen, dass mit dem Einsteigen eine Verwandlung geschieht, aber dann stellen sich erst die Fragen: Hatte ich mich je verwandelt? und Wo wollte ich hin?

Schließlich das abermalige Aufsuchen der Lebenswechsel-Haltestelle, diesmal mit dem Versuch die Situation jenes heißen, mich unversehens ein Labsal erfahren lassenden Tages zu wiederholen. So wird die Sitzbank des verdreckten Haltestellenhäuschens zu einem Ort der Selbstvergewisserung, und sei er auch noch so von Spraydosen, Filzstiften und scharfen Gegenständen völlig verkritzelt (»Graf-Recke-Straße«). Und dabei bleibt der Autor nicht bei philosophischen oder sonstwelchen metaphorischen Deutungen stehen, sondern weitet den Raum – durch Erzählen, so etwa in (auf?) der »Theodorstraße«: Die bekannte Diesigkeit mit verirrten Autolichtern, die aufblenden zwischen weiteren dunstwandlerischeren Abwesenheiten hier und da. Von den noch gut auszumachenden Silos Oberhausener Straße her die Ahnung bald ehemaliger, schon umso ferner liegender Altindustrien. Wie doch diese zuweilen häßlichen Haltestellen Peter Handkes Un-Orten gleichen (ich erinnerte mich an Christian Luckscheiters Buch »Peter Handkes Ortsschriften«). Paradoxerweise wird die Kontemplation manchmal durch das plötzlich und wundersam pünktlich erscheinende Verkehrsmittel gestört, umgeleitet oder geht verloren. Dennoch keine Regel ohne Ausnahme, und so freut man sich auch einmal über die freundliche Verläßlichkeit, als der in seinem Gelenk schwankende Glühwurm, der Gelenkbus, auftaucht.
Dann die Fahrten. Oft sind sie früh morgens oder nächtens, berufsbedingt von oder nach zu Hause des Ich-Erzählers, der, vage gehalten, etwas mit Luftfahrtlogistik zu tun hat. Sie werden, wie fast schon üblich bei Rabowski, zu kleinen Beobachtungs- und damit Entdeckungsreisen und spiegeln sich zu einem großen Teil in der Topographie Düsseldorfs (aber auch die Sahara, Brazzaville, die Ukraine und Japan kommen vor). Die U‑Bahn, [v]erklebter Haltegriff. Balancierende Tuchfühlungen. Ein schal gewordener Nivea-Geruch. Und dann die von der hereingetragenen Feuchtigkeit verschlierten Brillengläser einer Frau…wie sie ungefähr in meine Richtung sehen. Und die Idee, als wie erträglicher gemacht sie derart, ihre Umgebung wahrnehmen mag: Die Gesichter ausgewaschen in einem Verfließen von Regen, Dünsten, durch etliche Körper hindurch gegangenen Morasten aus dem x‑fach umgewandelten Schwitzwasser der Welt… (»Frau in der U‑Bahn II«).
Und so kündet das Haltestellen-Bild eben auch vom Reisen und Unterwegs-Sein; pathetisch ausgedrückt (und somit Anti-Rabowski-gemäß) vom Strom des Lebenden, dem man irgendwie nicht entkommen kann. Da ist die Angestellte von Eurowings im Zug, die ihr Gepäck um sich herum wie eine Burg gestellt hatte und die Schuhe ausgezogen und die Füße auf dem gegenüber liegenden Sitz ruhen ließ (»Perversionen«). Oder der gerade erst abfahrende Zug, der die Gesichter aller, die das Nachsehen haben zeigt (»Thalys«). Die letzte und längste Erzählung (»Der letzte Bus«) ist Elegie und Hymnus auf das Busfahren. Da klaffen im vorüberfahren über Baugerüsten mondlichterne Wolkenfetzen, in vom Wind hineingerissene Lücken irrlichtern halbfertige Himmel, wie vorläufig verpackt in ein knallendes Vlies aus wie tagblauem Propylen. Und die allzu vertraute City, jetzt ohne viel Verkehr, gibt sich in den angrenzenden Innenstadtbereichen noch hell und geräumig, bald schon verdüstert als forsch zu nehmende Verengung hinein in die Dunkelzonen eines zunehmend verrückten, wie zu oft falsch zusammengelegten oder von Bretterwänden grundabgerissenen Plans. Da verläuft auf einmal die eine Straße fort als die andere, in einer Zusammensetzung, die es so, außer in einem Sprung über Sektionen, gar nicht geben kann. Erinnerung des Lesers an die frühere Geschichte »Haltestellen I«, in dem der Erzähler bekennt, er suche im öffentlichen Nahverkehr manchmal beides, die leere fröhliche Fahrt, wie auch mein Verlorengehen in der sich unaufhörlich bewegen müssenden Menge. (Und Pascal sagte ja nicht nur, das alles Unheil daher komme, »dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können«, sondern auch: »Zu unserer Natur gehört die Bewegung, die vollkommene Ruhe ist der Tod«.)
»Haltestellen« ist womöglich ein sehr guter erster Zugang zur Literatur von Rainer Rabowski. Wenn man nachts oder früh morgens mit noch halb-schläfrigen Passanten in einem Bus oder einer Bahn sitzt, kann man es sogar dort lesen. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass nicht nur die Tageszeit der Rabowski-Lektüre von gewisser Wichtigkeit ist, sondern auch der Ort. Das ist ein gutes Zeichen.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

Rabowskis Sprache zeichnet die Reibung des eigenen Gedankenraums am Äußeren ganz präzise nach. Dabei kommt weder das Innere noch das Äußere zu kurz und wird vor allem sprachlich wunderbar überhöht. Eine Neuentdeckung für mich, die mich jetzt auch Dank Ihrer Kritik dazu veranlasst, mir erst einmal zwei Bände zuzulegen: »Erste Lieben« und »Haltestellen«.
Schön. Bin schon gespannt.
Und: Ich mag schmale, anspruchsvolle Bücher.