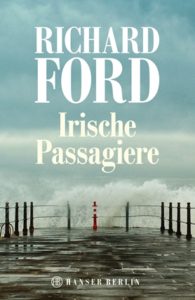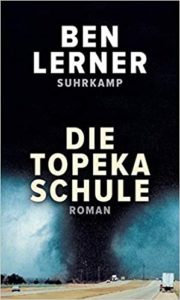(← 10/11)
Ich persönlich glaube nicht an die Mär von den armen ausgebeuteten Menschen; ich glaube nicht mehr daran. Im 19. Jahrhundert und bis weit ins zwanzigste hinein mag das zugetroffen haben; wahrscheinlich trifft es in den (vor allem südlichen) Weltgegenden zu, die deren Bewohner scharenweise verlassen, um in unseren Schlaraffenländern die anachronistische Rolle des Ausgebeuteten zu spielen (wir brauchen also doch noch welche). Hier bei uns, im Westen wie im verwestlichten Osten, sind die Menschen nun einmal zu dem geworden, was sie sind. Sie hatten und haben ihr Schicksal selbst in der Hand, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Diese Freiheit ist heute Wirklichkeit. Jeder Einzelne hätte auch ein anderer werden können. Es besteht nicht mehr der geringste Grund, Bevölkerungsschichten, ehedem »Klassen«, zu idealisieren und heroisieren, da sie als umreißbare soziale Gruppen im Aussterben begriffen sind. Auch wenn die ökonomischen Ungleichheiten größer werden, tendieren die meisten sozialen Elemente zur Mitte, und diese Mitte ist sehr breit geworden, auch wenn sich viele ihrer Mitglieder ökonomisch bedroht fühlen und in bestimmten Momenten – Finanzkrise 2008 – tatsächlich bedroht sind. Diese Mitte ist für die in der Dritten Welt Dahinvegetierenden das Schlaraffenland. »Die Welt zerfällt. Die Mitte hält nicht mehr«, sagt der afroamerikanische Historiker Cornel West mit Bezug auf autoritäre Politik und schrankenloses Profitstreben. Dies ist eine Prophezeiung, ein Kassandraruf. Tatsächlich wird sie wohl noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte halten, aber es könnte schon sein, daß innere Widersprüche und seine Schrankenlosigkeit das neoliberale System zur Implosion oder Explosion (oder beidem) bringen werden.1
West erwähnt gern die Helden des afroamerikanischen Freiheitskampfes, aber man hat den Eindruck, das alles sei definitiv Geschichte: Martin Luther King, John Lewis und so weiter. Didier Eribon beschreibt in Rückkehr nach Reims die Beschränktheit, den Rassismus, die Intoleranz, die in französischen Arbeitermilieus nach dem Ende der Arbeit herrscht, also unter Leuten, die sich als Zukurzgekommene sehen. Er hält trotzdem an den überkommenen soziologischen Kategorien fest. Sein Schützling Édouard Louis, dessen Schilderungen an Härte ebenfalls nichts zu wünschen lassen, ist da etwas freier. Auch dann, wenn Sympathie mit den Opfern der Modernisierung aufkommt, weint er dem Verschwinden der Arbeiterklasse keine Träne nach. Donald Trump, der dieser Klasse bekanntlich keineswegs angehört, ist oder gibt sich in dieser Hinsicht viel nostalgischer, also rückschrittlicher. Er verspricht den wirklich oder vermeintlich Zukurzgekommenen, was ihnen niemand geben kann. Aus wahltaktischem Kalkül vermutlich. Und weil er eine Ideologie verkörpert, die einen Schein aufrechterhält, dem, wie die Ideologen genau wissen, keine Wirklichkeit mehr entspricht. An der Beseitigung dieser Wirklichkeit haben sie selbst mitgewirkt.
Auch Cornel West läßt sich von rhetorischer Dynamik und ideologischen Vorgaben leiten und kümmert sich wenig um Fakten. So behauptet er, 40 Prozent der Bevölkerung der USA würden in Armut oder nahe an der Schwelle dazu leben. Die offizielle Statistik gibt als Zahl 11,8 Prozent an; dazu die Erläuterung, daß die Armut in den letzten Jahren kontinuierlich geringer geworden sei. Es ist übrigens aufschlußreich zu lesen, wie West es beklagt, daß schwarze Freiheitskämpfer, sobald sie in die Politik gingen, in den Sog des Neoliberalismus gerieten und ihre früheren Positionen aufgaben. Gibt es wirklich keine Alternative? Womöglich nicht. Cornel West outet sich als Mann des Blues: "Mit all diesem Schrecken trotzdem irgendwie klarzukommen, bedeutet, ein Mann oder eine Frau des Blues zu sein. Es bedeutet, Kummer zu akzeptieren, aber niemals dem Kummer und damit den Katastrophen das Feld zu überlassen." ↩