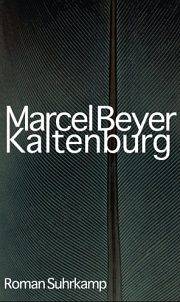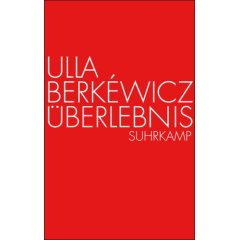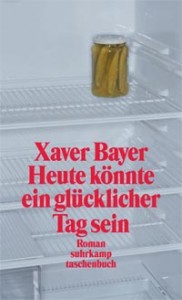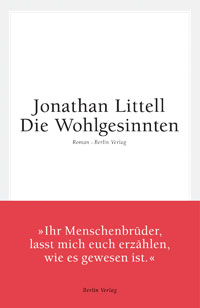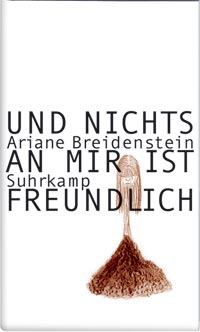Josef Winkler, Büchnerpreisträger 2008, in Neuss
Nach der Lesung aus einem Buch »Roppongi« wurde Josef Winkler aus dem Publikum gefragt, ob er einen Grund nennen könne, warum so viele, eigentlich die meisten wortmächtigsten, zeitgenössischen Schriftsteller deutscher Sprache aus Österreich kommen würden (Handke, Jelinek, Thomas Bernhard und natürlich auch Winkler).
Winkler überlegte kaum, antwortete sehr schnell, anfangs mit einer Art Stottern oder, besser, Stammeln, als hätte er die Frage schon Wochen vorher gewusst. Naja, sagte er, es gäbe doch auch einige sehr gute Schriftsteller aus der Schweiz. Gelächter im Publikum. Dann hatte Winkler seine Gedanken sortiert. Handke, Jelinek, Bernhard – das seien europäische Ausnahmeerscheinungen. Insbesondere Handke.