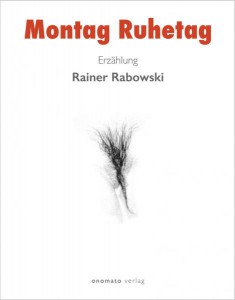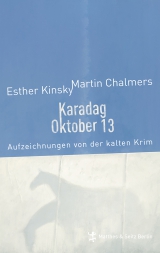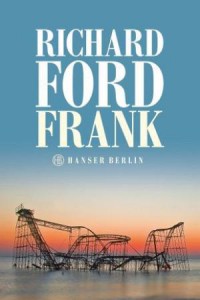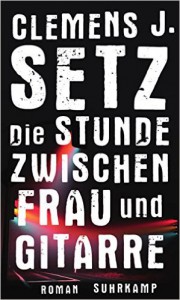Ein Interview mit Leopold Federmair, geführt von Masahiko Tsuchiya ‑1. Teil
Masahiko Tsuchiya: Du bist Autor, Übersetzer und Kritiker. Wie unterscheidest du dich voneinander und welche Beziehungen habt ihr zueinander? Kannst du zu antworten versuchen, obwohl dir die Unterschiede vielleicht nicht bewusst sind?
Leopold Federmair: Bei der Lektüre von sogenannten interkulturellen Schriftstellern, die die Sprache gewechselt haben und infolgedessen in einer Fremdsprache schreiben, habe ich bemerkt, daß einige von ihnen die sprachlichen Fehler, zu denen sie neigen, absichtlich produktiv machen. Die Fremdsprachigkeit wirkt auf ihren Stil. Das schicke ich voraus, weil ich deine Formulierung «Wie unterscheidest du dich voneinander?« äußerst anregend finde. Ich bin ich, aber ich bin auch ein anderer, oder mehrere andere. Ich bestehe aus diesen anderen. Rimbauds Satz »Je est un autre« ist heute schon ziemlich abgedroschen. Ich bin nicht ein anderer, sondern mehrere. Der Reihe nach und gleichzeitig. Das gefährdet nicht unbedingt die Einheit der Person (kann aber vorkommen, diese Gefährdung).
Die drei Aktivitäten, die du nennst, waren für mich nie streng getrennt. Alle drei sind verschiedene Bereiche von Literatur. Was ich einmal sogar als Titel für einen kleinen Aufsatz schrieb, muß ich immer wieder bekräftigen: DER ÜBERSETZER IST EIN AUTOR. Einige halten das ohnehin für eine Selbstverständlichkeit. Ich stoße aber immer wieder, auch jetzt vor kurzem wieder, auf Leute im Literaturbetrieb, die das überhaupt nicht so sehen. Manche Verlagsleute halten die Übersetzer für Küchengehilfen in ihrem großen Betrieb. Entsprechend behandeln und bezahlen sie sie.
In Bezug auf Literaturkritik war ich immer der Ansicht, daß eine gute Kritik eine kleine literarische Form realisiert. Als Kritiker muß ich häufig nacherzählen, Stimmungen und Eindrücke wiedergeben, Ausgesagtes verdichten. Ich habe nur begrenzten Raum zur Verfügung, muß aufs Wesentliche zielen, darf nicht zu sehr schweifen. Subjektive Eindrücke versucht der Kritiker so zu vermitteln, daß sie eine Allgemeinheit interessieren oder auch überzeugen. Das ist eine literarische Aktivität, jedenfalls so, wie ich sie betreibe. Bei einem Autor wie Jorge Luis Borges akzeptiert man selbstverständlich, daß in seinen gesammelten Werken auch ein Band mit Kritiken enthalten ist, und einer mit Vorworten.
Die, die am strengsten trennen wollen, sind meistens Akademiker, Universitätsleute. In Europa genauso wie in Japan. In den USA hat man an den Unis auch Platz für Schriftsteller, und sie müssen sich in dieser Eigenschaft nicht verleugnen.
Ich glaube, daß ich als Autor eine ähnliche Position habe wie Lafcadio Hearn vor über hundert Jahren. Auch Hearn war übrigens Übersetzer (aus dem Französischen). Und er hat für Zeitungen gearbeitet. Er lebte in ganz verschiedenen Ländern, war immer neugierig und hatte diesen ethnologischen Blick. Er wurde nie voll anerkannt, blieb immer Außenseiter. In Österreich haben wir einen Autor, der sich von vornherein als Universalgenie »positionierte«, wie man heute sagt. Das konnte und wollte ich nie, auch deshalb, weil ich nicht glaube, daß es noch Universalgenies geben kann. Deshalb habe ich das Konzept einer »transversalen Ästhetik« entwickelt, in Opposition zur globalisierten, globalisierenden Kultur. Interessant ist für mich nur, konkrete Punkte, Orte, Werke, Menschen miteinander zu verbinden. Allgemeine Schemata finde ich nicht interessant. Das Problem für Leute wie Hearn und mich ist, daß man uns immer aufs Neue in Schubladen steckt: der Journalist, der Beschreibungskünstler, der Sachverständige der neuen französischen Philosophie, der Übersetzer, der Japanophile, der Professor usw. Nein! Wir sind vieles und wissen das Viele unter einen Hut zu bringen. Wir sind ein plurales Subjekt.
Weiterlesen ...