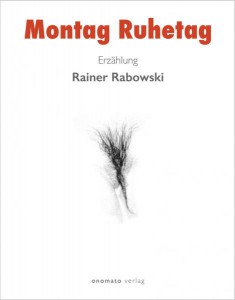Nach dem auch haptisch opulenten Erzählungs- und Gedichtband »Haltestellen«, der vordergründig vom Reisen und Unterwegs-Sein (im weiten wie im nahen) handelte, ist von Rainer Rabowski kürzlich das dezent-kleine Büchlein »Montag Ruhetag« erschienen. Wenn man Peter Handkes »Versuch über den Stillen Ort« als eine Geschichte über den vermeintlichen Un-Ort Toilette liest, der für den Erzähler immer wieder eben auch zum »Asylort« wurde, so ist »Montag Ruhetag«, dieses Triptychon aus drei Geschichten, die zu einer »Erzählung« zusammengefasst werden, vielleicht so etwas wie ein ‘Versuch über den Friseurladen’; auch er zuweilen Asylort, aber auch Folterstätte.
Natürlich findet sich auch in diesem Buch der für Rabowski typische Sound des psychologisch-reflexiven Realismus, diesmal fast ausschließlich verortet in Düsseldorf (selbst in Thailand erinnert er sich an einen Düsseldorfer Frisiersalon). Es ist aber deutlich weniger ein Sich-Selbst-ins-Wort-Fallen als sonst, was den Phänomenen mehr (Erzähl-)Raum gibt und den Leser mehr ins Nachsinnen versetzt. Etwa wenn er von der Schmach und Ohnmacht erzählt, als er als Kind auf den Friseurstuhl musste (»Haareschneiden ist eine Verletzung«). Oder der Lebensabschnitt, in der einem die Frisur als Distinktions- oder sonstiges Merkmal plötzlich nicht mehr wichtig war, ein Akzeptieren »in der Welt des Aussehens ein Außenseiter« zu sein und es trotzig genügte »gar keine Frisur« haben zu wollen. Dann war der Friseur auf dem Flughafen gerade recht; so wurde die Wartezeit halbwegs sinnvoll ausgefüllt.
Zwischenzeitlich entwickelt der infolge eines früh beginnenden Haarausfalls immer weniger frisierbedürftige Flaneur eine Phänomenologie der Friseursalons in Düsseldorf und startet ein privates Fotoprojekt (leider ist keines der Bilder im Buch) wobei es bei diesem Erzähler kein Wunder ist, dass ihm vor allem dann die kleinen, manchmal etwas schmuddeligen Nebenstrassenläden interessieren, die mit ihren engen Räumlichkeiten etwas »Oasenhaftes« bieten, eine Intimität, die dann aber immer wieder aus unterschiedlichen Gründen zum Problem wird.
Zum einen ist da eine »Scheu« nicht als Stammkunde bedient zu werden, was verblüffend mit Peter Handkes Diktum korrespondiert, nicht als »Stammgast behandelt werden« zu wollen, »nie und nirgends«. Rabowskis Erzähler sieht darin bereits eine Übergriffigkeit nebst Gefahr der (sozialen) Vereinnahmung (für was auch immer). Nichts hasst er so sehr wie Komplizen- und Seilschaften, was ihn einmal in fast bernhardeskem Übertreibungsfuror über Düsseldorfer Schützen- und Brauchtumsvereine herziehen lässt. Zum anderen allerdings leuchtet dann doch noch so etwas wie Menschen-Neugier hervor und die Bereitschaft, sich auf diese Welt der »braven Wella-Reklamen« einzulassen, allerdings ohne das letzte Gran von Geringschätzung für die Profession vollständig ausblenden zu können.
Natürlich kann das nie lange gutgehen und so enden diese Szenen in diesem Buch so etwas ähnlichem wie einem »Knacks«, über den einst Roger Willemsen so gekonnt philosophierte. Da bahnt sich, so Willemsen, etwas an, »tritt aus der Latenz ins Manifeste, und selbst der augenblickliche Schrecken eines Ereignisses hängt nicht so sehr mit seinem Eintreten als vielmehr mit seiner Anbahnung zusammen. Auf dem Kristallisationspunkt erscheint der Knacks.« Es ist nie der große Streit oder das theatralische Zerwürfnis. Es ist ein Blick, eine Geste, ein Bild, ein Wort oder auch nur eine bestimmte Intonation eines Wortes. Danach ist es nie mehr wie vorher. Rabowski erzählt nicht nur diese »Anbahnungen«, er reflektiert sie auch und dies derart, dass man es erst beim zweiten Lesen bemerkt, dann jedoch sofort das unerhörtes Geschehen, dass sich soeben ereignet hatte nachvollziehen kann, nachdem man es zunächst überlesen hatte (wenn man nur einen Moment unaufmerksam bei der Lektüre dieser Prosa ist, wird man sofort bestraft). Und nein, das hier wird keine Nacherzählung sein und dem potentiellen Leser werden nicht die Wahrnehmungen vorab auf einem Tablett serviert. Nur soviel: Der Erzähler verlässt den jeweiligen Ort – und zwar für immer und auch ein bisschen mit »Angst vor der eigenen Courage« und dabei geht es dann eben nicht mehr nur um das banale Haareschneiden sondern um nichts geringeres als das Verhältnis zur Welt mit dem Friseurladen aus Petrischale.
Es gibt fast wie nebenbei wunderbare Bilder, eine Mischung aus Tristesse und (dann doch) Geborgenheit wie das »Frisierkittelnylonblau« oder die »Trockenhaubengespenster« mit ihren Aluminiumröllchen. All diese im besten Sinne stimmungsvollen, ja anregenden Bilder und Allegorien werden ummantelt mit einem überaus dekorativen Coverbild einer »weiblichen Geschlechtsbehaarung« (vermutlich jenes aus einem Pariser Friseursalon, in dem der Erzähler einmal war).
Und dann also entgegen den hier üblichen Usancen eine Empfehlung, sich die 5 Euro (inklusive Versandkosten) für das Buch zu gönnen und direkt beim Verlag zu bestellen (Amazon hat es nicht auf Lager, was nichts heißen muss). Und ja, Rainer Rabowski hat hier gelegentlich publiziert (und macht es hoffentlich irgendwann wieder einmal) und wir haben auch schon einmal einen Kaffee zusammengetrunken, aber das trübt meinen Blick nicht – eher im Gegenteil.