»Unerschöpflich sind diese Bücher. Wie ich sie aufblättere, ist es mir beinahe unbegreiflich, zu denken, daß sie wirklich unter den Deutschen noch fast unbekannt sein sollen.« Diese Sätze schrieb Hugo von Hofmannsthal 1904 nach dem Tod von Lafcadio Hearn, und sie sind mehr als hundert Jahre später zu wiederholen. Der ungreifbare, nomadisierende, in unterschiedlichen Genres tätige Autor: daß sich an seiner Situation posthum etwas Entscheidendes ändern wird, ist zu hoffen, wenngleich man es bezweifeln mag. Der Übersetzer Alexander Pechmann tut das Seine dazu, in einer hervorragenden Arbeit von Präsentation, Einfühlung und Wiedergabe. Im Nachwort zu seiner Ausgabe des Romans Chita. Eine Erinnerung an Last Island situiert er Hearn literarhistorisch zwischen Robert Crane, R. L. Stevenson und Joseph Conrad.
Ein angelsächsischer Autor, gewiß. Vielleicht amerikanisch. Interkulturell und mehrsprachig wie Conrad. Neugierig auf Abenteuer wie Stevenson. In Griechenland geboren, in Frankreich zur Schule gegangen, nach Irland und in die USA geschickt, damit ihn die Familie loswird. Von Cincinnati nach New Orleans geflüchtet (oder wieder vertrieben). Dann Martinique, dann Japan, damals ein fast ganz unbekanntes Land – Hearn trug viel dazu bei, es jenseits eines gefälligen Exotismus bekannt zu machen. Die letzten 14 Jahre bis zu seinem Tod. Hearns’ Werk ist heterogen, es zeugt von einem mühsamen Lebenskampf, auch wenn die Mühen in den Texten durchaus nicht immer durchklingen. Chita zum Beispiel ist ein sorgfältig gewirkter Roman mit zahllosen Naturbeschreibungen, die ebenso wie die langsame, dann doch wieder beschleunigte Erzählbewegung an Adalbert Stifter erinnern. Erzählung einer Gegend, der Inseln und Bayous und Sümpfe in Louisiana, am Golf von Mexiko; aber auch eines verwaisten Mädchens und seiner Pflegeeltern.
Man kann nicht umhin, bei der Beschreibung des gewaltigen Sturms, der im August diese Gegend heimsuchte und mehrere Inseln verwüstete, an den Hurrikan Katrina zu denken, der 2005, ebenfalls im August, New Orleans zerstörte. »Zerstört«, das ist das Wort, das Anna Kazumi Stahl gebraucht, eine ähnlich interkulturelle, neugierige und mehrsprachige Autorin wie Hearns. Sie wuchs in New Orleans auf, hat deutsche und japanische Vorfahren, lebt aber heute in Buenos Aires und schreibt in spanischer Sprache. Nach dem August 2005 konnte sich New Orleans nicht erholen, und zwar weniger, weil es an Geldern zum Wiederaufbau gemangelt hätte, sondern weil die alte, so spezielle, kreolische Kultur mit ihren so unterschiedlichen Einflüssen seitdem verschwunden ist. In Chita erfährt man vieles über jene Phase, in der sich die Menschen und das, was sie mitbrachten, ihre Sprachen, Dialekte, Ängste, Überzeugungen, Glaubenssätze, Fertigkeiten noch in Austausch und Vermischung begriffen waren. Hearn durchsetzt seinen englisch-amerikanischen Roman mit Fetzen, manchmal ganzen Dialogen in Spanisch, Italienisch, Sizilianisch, Französisch, Mischdialekten. Der Autor selbst besaß ein großes Sprachentalent, er war auch als Übersetzer (aus dem Französischen) tätig.
Literatur kann und soll auch Wissen vermitteln, Wissen über ferne Länder und Zeiten, aber auch über innere Abgründe und persönliche Befremdlichkeiten. Ein anderes Wissen als das, das man sich geschwind herbeigoogelt, um es ebenso rasch zu vergessen. Hearn verbindet diese Absicht der Erkundung und des Verstehens mit einem Genauigkeitsstreben der Beschreibung, der Wiedergabe von Gehörtem, der Sicherung von historischen Tatsachen. Das macht ihn zu einem der Vertreter jener Literatur des 19. Jahrhunderts, die man heute, im Zeitalter der Leichtigkeit, mitunter als ein wenig schwer empfinden mag. Solche Erzählungen bewegen sich wie die Dampfer in den Bayous, die damals oft die einzige Möglichkeit boten, bestimmte Ziele zu erreichen. Für die Lektüre muß man sich ein wenig Zeit nehmen (auch wenn Chita nicht mehr als ein »kleiner« Roman ist), aber die Mühe lohnt, der Zeitverlust ist ein Zeitgewinn. Wir können immer noch vom 19. Jahrhundert lernen, vor allem dann, wenn der Vermittler dessen Sprach- und Geisteshaltung so gut nachzuempfinden und weiterzugeben versteht.
Lafcadio Hearn: Chita. Eine Erinnerung an Last Island. Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann. Salzburg, Jung und Jung 2015.
© Leopold Federmair
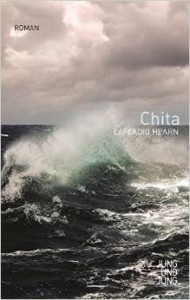
Hm ... wenn ich literarische Texte streng als fiktional betrachte, dann bekomme ich mit dem Begriff »Wissensvermittlung« Probleme (vor allem dann, wenn das Buch alt ist und ich mich in der betreffenden Lebenswelt nicht gut auskenne).
@mete
Ist nicht auch der Umgang mit Fakten Konstrukt?
„Die Wahrheit hat die Struktur einer Fiktion.“ (Lacan)
Außerdem gibt es alle möglichen Formen von Wissen. Die strenge (die unbezweifelbare) ist oft genug die dürftigste.
@herr.jedermann
Fiktion ist ungleich Konstruktion, richtig?
(Ich würde mich eher nicht auf Lacan stützen.)
Ich war mir beim Schreiben auch nicht ganz sicher, ob »Wissensvermittlung« das rechte Wort ist. Lafcadio Hearn schreibt in diesem Buch nicht über selbst Erlebtes, die Geschichte spielt sozusagen vor seiner Zeit. Bemerkenswert finde ich die Sorgfalt, mit der er mit Realität umgeht. Zugleich ist das Buch aber Fiktion. Aber nicht »faction«, wie es heute heißt, sondern eine sehr gut erzählte und gemachte Fiktion auf der Basis von dem, was ihm an Überliefertem zur Verfügung war, gepaart mit eigener Anschauung, weil er die Orte, an denen die Geschichten spielte, kannte. Ich denke doch, daß diese Art, etwas Reales, wirklich Stattgehabtes, zu vermitteln, eine spezifische Leistung von Literatur ist, eine ihrer möglichen Aufgaben. Dabei geht es nicht um Fakten, die man sich auch anderswie und anderswo besorgen kann, sondern – wieder ein problematisches Wort – um das Leben, um Gelebtes, um Erfahrenes, das ich als Leser selbst vielleicht nie erfahren kann, z. B. deshalb, weil ich nie in die erzählte Gegend oder in die erzählte Zeit komme. Das wäre auch eine Rechtfertigung für das, was man Exotismus genannt hat. Durch die heutigen Kommunikationstechnologien und erschwingliche Fernreisen scheint diese Art Exotismus obsolet zu sein. Ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt, weil jene Medien und dieser Tourismus auch nicht alles zugänglich machen.
Beim nochmaligen Lesen des Artikels bin ich sogar versucht zu sagen – weil es ja auch in der treffenden Vermittlung duchscheint: Diese, die angesprochene Art ist eine überlegene Art Wissen, eben Literatur: verdichtetes, durchgearbeitetes Erfahrungswissen!
Insofern meine ich auch zu verstehen, was die angedeutete Qualität des 19. Jahrhunderts wäre. Eben langwelligeres Tiefenwissen, da es noch Zeit hatte, sich zu setzen. (Was per se kein Argument wider die beschleunigte Gegenwart sein muss, doch ist es eben von einer anderen Sorgfalt, eine Alternative.)
Ich weiß nicht genau, warum, aber ich muss auch noch an einen womöglich ähnlichen Effekt beim Lesen von Fuentes’ „Der alte Gringo“ denken. Oder hat das sogar etwas mit den weniger exotischen als archaischen Hintergründen zu tun? Mit Zeitenwechseln vor Landschaften in entsprechend geführten Figuren? Eine neuere Quelle für diese spezielle Art Qualität wäre vielleicht Cormac McCarthy. Das Ausgedrückte ist fast immer eher karg, dabei aber hoch aufgeladen – ein implizites Wissen als Geistigkeit.
(Wenn man sich auf Lacan nicht stützen will, kann man ihn als Unterwanderer unserer oft so brav abgezirkelten Begrifflichkeiten hernehmen: Es ist auch gut, seine Gewissheiten immer wieder mal kurz ans Bodenlose zu rücken.)
Ganz heikles Thema, die Fiktion als Welteinfänger. Ist möglich, meiner Leseerfahrung nach, aber immer an Gemeinsamkeiten geknüpft. Will sagen: der Abenteurer aus »meinem Kulturkreis« kann mir ein derartiges Tableau verschaffen. Bislang hatte ich aber kein »Importerlebnis«. Chinesische Literatur lässt mich ratlos zurück. Beispielsweise. Oder Afrikanische. Es scheint nur eine Richtung zu geben: von »hier« nach anderswo, mit den Weisen des Denkens und Fühlens im Gepäck. Und dann kommt der Brief nach Hause...
Danke für diesen anregenden Literaturtyp. Skeptisch bin ich allerdings, ob Literatur Wissen von Welt vermittelt und ob das ihre Aufgabe sein soll. Zumindest nicht im Modus eins-zu-eins und insofern also nur mittelbar. Liefert uns Balzac tatsächlich ein Bild der französischen Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts, oder lesen wir darin nicht vielmehr eine bestimmte Weise der Darstellung, die sich mit dem Begriff ästhetischer Performanz umschreiben läßt? Was dann eher auf die ästhetische Form, die sich an den Inhalt bindet, hinausläuft.
Die Wahrheit hängt sicherlich vielfach auch mit Fiktionen zusammen. Wenn aber das Zahnbohrinstrument des Zahnarztes sich dem Nerv nähert, ist es gut, wenn die Wahrheit der Anästhesie sich nicht nur als Fiktion erweist.
Mancher Brief erreicht niemals seinen Bestimmungsort, geht (unfehlbar) verloren und fehl. Briefe sind nicht Odysseus und es gibt in der Ästhetik keine Gewähr dafür, daß sich die Entfremdung aufhebt und die Reise in die Ferne in Ankunft aufgeht, so wie die Wahrheit und der Gang von Herr Bloom am Ende seines Tages in jenem ekstatischen Monolog der Molly Bloom mündet. Genau an diese verpaßten Ankünfte knüpft sich die Literatur. In einem Konzept der Weltliteratur würde ich sagen: es ist egal, ob das Erzählte aus China oder aus dem Iran oder aus Nigeria stammt und von einem Autor aus diesem Kulturkreis erzählt wird. Wer begreift und weiß, in welch unterschiedlichen Weisen literarische Texte gebaut sein können, der wird auch diese Bücher lesen können. Zumal man davon ausgehen kann, daß all diese uns fremden Autorinnen und Autoren an einen kollektiven Erzählstrom andocken, der wesentlich von einem bestimmten Erzählkonzept tangiert ist, das wir mehr oder weniger teilen. (Okzidental-oriental oder wie man es nennen mag.) Was eben nicht heißt, dieses Konzept zu verabsolutieren. Denn das Prinzip von Weltliteratur ist es ja gerade, ein ganz anderes Moment einfließen zu lassen: etwas das uns unaufhebbar entfremdet und vom Ich absehen läßt. Solche Fremdheit im Wissen finden wir bereits, wenn wir die frühen Texte abendländischer Dichtung lesen: Ob Homer, Sophokles oder Ovid. Obgleich aus einem Kulturkreis stammend, der zwar auf uns weist, sind diese Werke zunächst einmal fremder als jeglicher Text aus dem China der Gegenwart. Lesen heißt, sich überraschen zu lassen von Texten, die uns fremd sind.
Ich stoße mich nur an dem Begriff »Wissen«, weil gerade an diesem Ort immer viel Wert auf den Fiktionscharakter von Literatur gelegt wird (richtiger Weise, wie ich meine). Ich verstehe schon was gemeint ist und ich stimme auch zu, dass das eine Möglichkeit ist, die der Literatur offensteht.
Was Fiktion und Wissen trennt, ist, dass letzteres aus ersterem durch einem Abgleich mit der Realität entsteht (streng genommen bleibt Wissen immer eine Konstruktion oder ein Konzept [es entsteht unter Bedingungen und Annahmen]). — Wissen sagt etwas über die Welt, das wir für wahr – besser: in einem gewissen Maß für zutreffend – halten. — Ich muss mich nicht entscheiden, welches überlegen ist, das sind ganz verschiedene Kontexte.
[Ja, man kann Spielereien wie den zitierten Satz, der schlicht aussagelos ist, als Unterwanderung begreifen; seltsamerweise tut das im Fall der Literatur aber niemand der am Gegenstand Interesse hat mit irgendwelchen dampfplaudernden Fernsehzirkeln; ich halte das im Fall der Erkenntnistheorie schlicht für verantwortungslos.]
zu #7: So perfekt hab ich das noch nirgends gelesen! Alles, was garantiert falsch ist an diesen unseren Auffassungen über »Literatur« in knappen dichten Sätzen. Unbedingt konservieren... Allein der Begriff lässt ja schon ganze Kiefernwälder erschauern.
Man mag mit der Leichtigkeit Nietzsches über die Dinge gleiten („über den Wassern zu singen“) oder in den Tiefen ästhetischer Theorie sich der Sache der Kunst nähern: Doch die Randfichten werden immer bleiben. Leider. Unabholzbar.
Um Ihren einstmaligen Hang zur SPD noch zu befriedigen: Hören Sie „Blue Yodel für Herbert Wehner“ von der Band »Freiwillige Selbstkontrolle«!
@metepsilomena (vor allem)
Die kleine Debatte hier hat mich auf den hübschen Hegelschen Begriff des »sinnlichen Wissens« zurückgeführt: Wissensform und Erkenntnisweg, den Hegel der Kunst zuschreibt. »Erfahrungswissen« meint wohl etwas ähnliches. Joseph Conrads »Herz der Finsternis« vermittelt dergleichen, aber auch Rilkes »Malte«. Oder Reportagen von Joseph Roth, García Márquez oder wem auch immer.
Vielen Dank, werter Leopold Federmair, für diese Literaturempfehlung! Welch eine Bereicherung!
In den 80iger Jahren las ich von Gabriel García Márquez »Das Abenteuer des Miguel Littin« und wie bei der damaligen Lektüre empfinde ich bei »Chita« ab Mitte der Erzählung, eine Pause einlegen zu wollen. Warum? Weil das Gelesene dermaßen voll von Informationen, Bildern und Gefühlen ist, dass ein weiter lesen, ein schnell zu Ende lesen, mir Lese-Lebegenuss nehmen würde.
Theodor Fontane hält in seiner Lyrik, wie z.B. »Das Trauerspiel von Afghanistan« oder mit »Goodwind-Sand« ähnliche Katastrophen in Wort fest. Im Vergleich zu Hearn sprachlich nicht erreichbar, aber doch von Seiten der Information, des Mitfühlens, der Bilder, ähnlich.
Nach »Chita« wünschte ich, siehe auch »Meister und Margarita« von Bulgakov in der Übersetzung von Alexander Nitzberg, dass Hearns Werk in unserer Zeit Anerkennung finden würde. Jedoch, so denke ich, wird vielen Lesern die langsame Erzählweise nicht zusagen.
Für mich jedoch ist »Chita« durch »Begleitschreiben« eine Entdeckung und wahrlich eine Perle!
Hier eine Besprechung zu Lafcadio Hearns Roman »Youma« (von Jana Volkmann via Leserin Janette Bürkle).