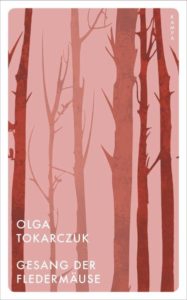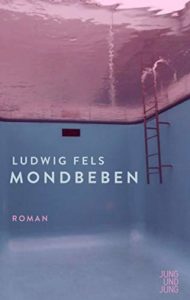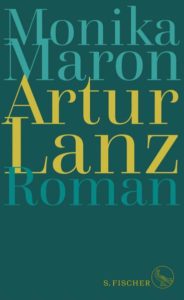
»Er war vielleicht fünfzig Jahre alt, von schmaler Gestalt, mit blondem, leicht ergrautem Haar, das in kurzen Locken wirr um seinen Kopf stand, als würde er es ständig mit den Händen durchfahren.« So beschreibt die Ich-Erzählerin Charlotte Winter in Monika Marons neuestem Roman die Titelfigur Artur Lanz. Sie sieht ihn vor dem Supermarkt, dort, wo auch Obdachlose zusammenkommen. Winter sucht ein Gespräch mit einem verzagten Mann, der die Streuner fast bewundert: »Die haben es doch gut, die haben es hinter sich…Die stellen keine Fragen mehr, die brauchen keine Antworten mehr. Alle Fragen heißen nur noch Schnaps und Bier und alle Antworten auch, bis es endgültig vorbei ist.«
Es dauert Monate, bis sie ihn wiedertrifft und vom »Drama« erfährt, dass »in der Männerseele von Artur Lanz tobte«. Sein Einsatz zur Rettung seines Hundes aus einem Rapsfeld beglückte und veränderte Artur Lanz’ Sicht auf das Dasein derart, dass er alles hinter sich ließ, was sein Leben bisher strukturierte. »Ein tiefes Glück« stellte sich ein, und sein Körper empfand einen »süßen Schmerz.« Es ist einer der Schwachpunkte des Romans: Die Euphorie Arturs teilt sich dem Leser nicht mit. Man denkt unwillkürlich an den großartigen Dag Solstad und eine seiner Hauptfiguren, die ihr Leben ändert, weil sie einen Regenschirm nicht öffnen kann.
Hier bleibt das Ereignis Behauptung und die Folgen scheinen eher absurd: Artur Lanz ließ sich scheiden, mietete sich eine neue Wohnung, wurde herzkrank, und stürzte sich in ein »wirres Herumdenken«. Seine Arbeit als Physiker verrichtet er ohne Enthusiasmus als Broterwerb. Und er erzählt Winter von seinem Vater, den Eltern, der ehrgeizigen Mutter, seiner Kindheit, von der Hypothek, die er durch den Namen bekam, den ihm die Mutter gab: Artur – der Held der Artussage. Welche Verpflichtung. Aber, auch hier ernsthaft gefragt, sind zum Beispiel alle Felixe derart prädisponiert, wenn sie herausgefunden haben, nicht permanent glücklich sein zu können?