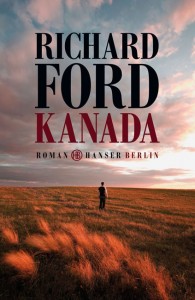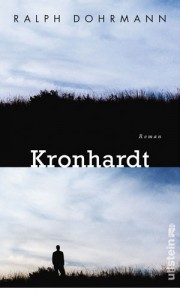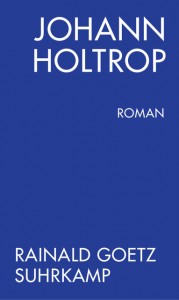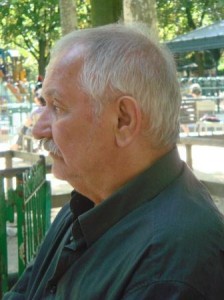Über den notorischen Außenseiter Gerd-Peter Eigner – [hier Teil I]
Als Schüler stieß Eigner, sein Interesse für Literatur und Kunst war kaum erst erwacht, auf die Werke manieristischer Künstler und ließ sich, wohl nicht zufällig, sondern in Übereinstimmung mit dem, was er selbst zu Werden im Begriff stand, davon faszinieren. »Also das ist es. Manie, Manierismus, die Aufhebung der Standfestigkeit, Erstarrung, Entkörperlichung. Und zugleich und nicht zuletzt, in seiner Wirkung – Mater Dolorosa –, dieser Taumel und Sog. Er war im Einklang mit dem, was er sah.« Taumel, Rausch, Entgrenzung... das Dionysische. Nietzsches Zarathustra steckt als Reclambändchen in Brandigs Jacke, während er die Statue Giordano Brunos auf dem Campo de’ Fiori umkreist. Von einer selbstzerstörerischen, zugleich selbstentdeckerischen sexuellen Obsession spricht Ulrich Horstmann mit Bezug auf Eigners Helden. Abgesehen davon, daß diese Obsession bei manchen Zeitgenossen Unbehagen hervorruft, stimuliert sie auch die Manie des Schreibens, insofern die Alter-Egos des Autors einem Ideal nachstellen (Nachstellungen heißen zwei Essay-Bände Eigners), das in den Romanen schwer und in der Wirklichkeit kaum zu haben ist. In ihrem aus Manien geborenen Realismus haben Eigners Bücher am Idealischen teil, das der Wirklichkeitsfeier, die sie vollziehen, zu widerstreben scheint. Sene Autobiographie legt den Schluß nahe, daß die Unnachgiebigkeit dessen, der sich seit seiner Jugend als Autor, als Selbst-Schöpfer, versteht, den inhaltlich-poetischen Kern eines Werks ausmacht, das sich von Beginn an gegen Widerstände durchsetzen mußte. Nach vorläufigen Zu- und späteren Absagen zu den ersten Manuskripten, die er an Verlage schickt, hält Eigner auf dem Markplatz in Bremen drei öffentliche Lesungen ab, die jedes Mal von der Polizei unterbunden werden. Ein halbes Jahrhundert später ist der Versuch seiner Wilhelmshavener Verfolgerin, Veröffentlichungen und Auszeichnungen Eigners zu verhindern, nur ein weiterer Akt in den eingespielten Bahnen der öffentlichen Ordnung, die sich durch künstlerische Freiheit – vielleicht nicht ganz zu unrecht – gefährdet sieht.
Weiterlesen ...