Dell Parsons ist 1945 geboren. Er erzählt im Jahr 2011, als pensionierter Lehrer, über die Zeit zwischen August und Oktober 1960. Eine Zeit, die sein Leben radikal verändert und geprägt hat. Der durchaus furios daherkommende Anfang lässt hoffen: »Zuerst will ich von dem Raubüberfall erzählen, den meine Eltern begangen haben. Dann von den Morden, die sich später ereigneten.« Fast lakonisch wird ergänzt: »Der Raubüberfall ist wichtiger, denn er war eine entscheidende Weichenstellung in meinem Leben und in dem meiner Schwester«.
Aber nun beginnt ein unendlich in die Länge gezogenes, zähes Rekapitulieren über sich selber, seine Zwillingsschwester Berner und ihre Eltern, Vater Bev (geb. 1923), seine Frau Neeva (geb. 1926), über Great Falls, Montana (die Familie lebt seit einigen Jahren dort) und die prekäre finanzielle Situation. Der Vater, einst Flieger in der Armee (er warf Bomben auf Japan im Zweiten Weltkrieg), verlor seinen Captain-Rang und wurde entlassen (allerdings mit belobigender Urkunde). Er schlägt sich als Auto- und Ranchverkäufer mehr schlecht als recht durch. Die jüdische Mutter arbeitet als Lehrerin, schreibt in ihrer Freizeit Gedichte, ist Bev intellektuell überlegen und entdeckt etwas zu spät, dass sie den falschen Mann geheiratet hat. Man erfährt von den illegalen Fleischgeschäften, die Bev bei der Armee abgewickelt hatte und jetzt wieder aufnahm. Als die Lieferanten auf Bezahlung ihrer Ware bestehen, der Abnehmer jedoch aus fadenscheinigen Gründen nicht zahlt, bekommt er Probleme und anonyme Anrufe (jeder Anruf wird protokolliert und erwähnt). Auf Seite 120 begehen die Eltern schließlich (endlich!) den Bankraub, auf dessen schicksalhafte Rolle vorher immer wieder hingewiesen wurde. Es dauert nicht lange und sie werden verhaftet. Um die Kinder kümmert sich überraschenderweise niemand. Sie besuchen ihre Eltern am nächsten Tag im Gefängnis. Es wird das letzte Mal sein, dass sie sie sehen.
Bis Mildred Remlinger, eine Freundin der Mutter, Dell einige Tage später abholt (Berner war in der Nacht vor Mildreds Besuch alleine aufgebrochen und verschwunden) vergehen weitere 110 Seiten. Dell kommt nach Saskatchewan, Kanada, zu Mildreds Bruder Arthur, der in einem gottverlassenen Nest ein zwielichtiges Hotel betreibt. Zunächst kümmert sich Charley Quarters um den Jungen. Charley ist Remlingers Faktotum, ein stinkender, hässlicher Mensch, der sich schminkt und Hitler verehrt. Die vier Wochen, die auf rund 60 Seiten ausgebreitet werden, sind in vielerlei Hinsicht ein Alptraum für den Jungen. Bis zum zweiten schicksalhaften Datum (dem 14. Oktober) sind es dann noch einmal rund 100 Seiten. Inzwischen hatte Remlinger Dell eine Kammer im Hotel zur Verfügung gestellt. Er musste Putz- und Laufdienste im Hotel verrichten. Remlinger, der wie Dell Amerikaner ist, wirkt in dieser Wildnis zwischen Eisenbahnarbeitern und Gänsejägern verloren und deplatziert. Schließlich wird Dell von Charley eingeweiht: zwei Männer seien unterwegs, die Remlingers Beteiligung an einem Bombenanschlag vor vielen Jahren herausbekommen haben. Schließlich geschehen die beiden Morde – begangen von Arthur Remlinger an den beiden Besuchern. Dell wird Zeuge dieses kaltblütig verübten Verbrechens (das krasse Gegenteil dessen, was die Eltern mit ihrem stümperhaften Bankraub veranstaltet hatten) und entkommt schließlich mit Hilfe von Remlingers Lebensgefährtin Florence, einer Malerin, die ihn zu ihrem Sohn ins 800 km entfernte Winnipeg schickt. Dort geht er dann offensichtlich zur Schule und kommt in geordnete Verhältnisse. Knapp erfährt man, dass er Lehrer geworden ist, geheiratet hat (die Ehe blieb kinderlos) und seit 35 Jahren kanadischer Staatsbürger ist (der Antagonismus Kanada / USA wird immer wieder am Rande angesprochen).
Der Kern des Buches sind die knapp drei Monate zwischen August und Mitte Oktober 1960. Sie werden in einer schier endlosen Zeitlupe gedehnt und machen mehr als Dreiviertel des Buches aus. Dabei wird jedes Lächeln entschlüsselt, jeder Blick interpretiert, jedes Schuheputzen geschildert, jede Stimmungsschwankung der Eltern nachträglich gewichtet. Immer wieder wird erwähnt, dass Dell damals 15 Jahre alt war und wie groß die Wesensunterscheide zu Berner waren (als genüge es nicht, sie zu erzählen). Später erfahren wir auf fast jeder zehnten Seite, dass er Charley nicht mag und Arthur Remlinger schütteres blondes Haar hat. Es sind Redundanzen ohne literarische Kraft; sie wirken protokollhaft angeklebt, als wolle Dell, der mit seinem guten Gedächtnis prahlt, mit diesem Präzisionsfuror Empathie beim Leser erzeugen. Aber all dies öffnet keinen doppelten Boden, zeigt keine neue (Lese-)Perspektive und lässt mich kalt. Zeitweilig denkt man, es entsteht so etwas wie ein Bildungs- oder Entwicklungsroman, da Dell immer wieder seinen Wissensdrang in einer Schule stillen möchte, geradezu eine Sehnsucht danach entwickelt. Aber auch diese Spur verödet irgendwann in der kanadischen Wildnis.
Schließlich würzt Dell seine Äußerungen noch mit Lebensweisheiten, die mal ins mystische (»Wir sind alle ein Mysterium«) mal ins nebulös-ungefähre abdriften (»Über die Jahre habe ich mir angewöhnt anzuerkennen, dass jede Situation, die mit Menschen zu tun hat, auf den Kopf gestellt werden kann«) und damit zu oft die Qualität von chinesischen Glückskeksen bekommen. Fast immanent für diese Haltung ist ein fataler Schicksalsglaube, den Dell dem Leser immer wieder aufzwingt, etwa wenn er die Familie »im Rückblick als dem Untergang geweiht« betrachtet oder von den »handfesten Ereignissen« philosophiert, die »den Verlauf eines Lebens«, des »Schicksals«, bestimmen. Der Kommentar zum Verscharren der ermordeten Amerikaner, an denen Dell mithelfen musste, klingt da exemplarisch für den ganzen Roman: »All das zusammengenommen ergibt schon das Maximum an Sinn in dieser Geschichte, mehr ist nicht drin.«
Sprachlich ist der Roman eine große Enttäuschung. Ein ungelenker Verkündigungston dominiert das Buch. Fords Erzähler liefert immer noch die Interpretation dazu. Die suchende Bewegung wird nur imitiert; stattdessen wird immer nur gewusst. Das ist nicht nur mit der Übersetzung erklärlich. Aber obwohl Frank Heibert ein Könner seines Fachs ist, gibt es einige Sätze, die merkwürdig daherkommen (oder wer versteht das: »Ich steckte die Hände in den Taschen, um nicht ständig die Augen vor dem Licht zu schützen, die mir schon wehtaten«). Vielleicht hat es mit dem Betrieb zu tun und man sollte Stefan Zweifels Appell an Verlage und Übersetzer einfach Ernst nehmen.
Merkwürdig bei all dieser Detailversessenheit sind einige Ungereimtheiten (die einem eben deswegen besonders auffallen). Mal ist Ende August der Herbst eingekehrt und es wird kühl, am nächsten Tag ist von einer lauen Sommernacht die Rede. Zwar liest man vom Freitod von Dells Mutter, aber der Urteilsspruch über den Vater wird niemals erwähnt. Und ziemlich unglaubhaft ist es, wie Charley in dieser weltabgeschnittenen Einöde von der geplanten Ankunft der beiden Amerikaner inklusive deren Namen und Hintergründe erfahren haben will.
Der Gegensatz zum deklamatorischen Dell ist Berner, die burschikose Schwester, die am Leben landläufig betrachtet Gescheiterte, ehemalige Trinkerin, mehrmals Verheirate und tödlich an Krebs Erkrankte (sie stirbt 2010 und hatte eine Woche vorher ihren Lebensmenschen noch geheiratet). Die letzte Begegnung mit ihr, die sich überraschend nach ihrem Vater »Bev« nennt, ist der Höhepunkt dieses Buches. Hier wird endlich episch erzählt, die Dialoge sind melancholisch ohne Sentimentalität und das schicksalsschwangere Gerede unterbleibt. Und endlich sind die gegenseitigen Liebesbekenntnisse in diesem Buch echt. Aber diese letzten dreißig Seiten retten »Kanada« nicht mehr. Ford bleibt nahezu alles schuldig, was seine Bücher sonst auszeichnen.
Ich klappte das Buch zu und dachte, was das wohl für eine fulminante Kurzgeschichte hätte werden können. Und man denkt sofort an einen Satz des großen Christoph Ransmayr: »Geschichten ereignen sich nicht, Geschichten werden erzählt.« Ich bin sicher, Richard Ford weiß das auch.
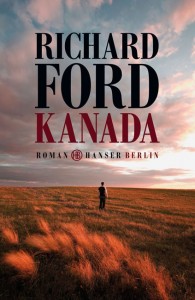
Danke für die informative Rezension.
Herzliche Grüße
Klausbernd :-)
Es ist möglich, wie Sie schon selber zugeben, daß die deutsche Übersetzung sprachlich nicht auf der Niveau der Amerikanischen Original ist.
Ford ist ein Meister der Sprache, und seine Erzähler, unter anderen auch der Erzähler von Kanada, sind fast lebendige Menschen deren Sätze klingen wie Stillleben klingen würden wenn sie singen könnten.
Einige meiner Gedanken zum Roman hier –
http://goaliesanxiety.blogspot.com/2012/05/canadas-narrator.html
Wussten Sie, daß Ford eins Peter Handkes Lieblingsautoren ist?
Und letztendlich, hier, in »Kanada«, haben wir wieder die Stadt Great Falls, wie auch, angeblich, am Ende von »Der Große Fall«.
. . . habe auch Ihr Handke Buch jetzt und schreibe bald etwas darüber.
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Stefan Zweifel geht in der »Literaturclub«-Sendung ja etwas genauer auf das Verfahren ein: Zunächst werden die Rechte an dem Buch unter den Verlagen sozusagen versteigert (was dazu führt, dass Fords Werk in vier oder noch mehr Verlagen erschienen ist). Dann werden die Übersetzungen »ausgeschrieben«. Dabei ist die Zeit wohl limitiert, denn der Verlag will das Buch natürlich so schnell wie möglich publizieren. Womöglich ist Heibert, der ja sehr gut und stimmig »Die Lage des Landes« übersetzt hat, in diese Räder gekommen.
Ihr Link, der sich ja mit einer Kritik zu diesem Buch beschäftigt, ist sehr interessant. Die Rezensentin kommt anscheinend mit der Art des redundanten Erzählens von Dell Parsons nicht zurecht. Und das ist auch das, was mich so gestört hat. Dabei ist das Zwillingsbeispiel noch sekundär für mich. Auch bin ich nicht gegen sich wiederholende Erzähler. Es kommt immer darauf an, worin der poetische Nutzen eines solchen Verfahrens liegt. Dell ist ein sehr umständlicher Erzähler. Dieses Klingen der Sprache der Menschen habe ich nicht gehört. Ich hatte stellenweise den Eindruck, da sei eine mündliche Erzählung transkribiert worden, und dies eben nicht »geglättet«, sondern ohne Veränderung. Dabei berichtet Dell sehr langatmig und will dabei Empathie erzeugen, was ihm jedoch nicht gelingt (oder, um präzise zu sein: bei mir nicht gelingt, aber vielleicht liegt ja der Fehler bei mir).
Dass Richard Ford ein sehr guter Erzähler ist, zweifle ich nicht an (dass er einer der Lieblingsautoren von Handke ist, war mir allerdings neu). Vielleicht liegt es wirklich an der Übersetzung.
(Bin sehr gespannt, was Sie zu meinem Buch schreiben werden.)
Im Radio (Kultur-Radio des rbb) wird das Buch seit heute vorgelesen, jeden Tag eine halbe Stunde (& das wird dann nachts nochmal wiederholt). Vorleser ist der »übliche«, also der allseits verwendbare Christian Brückner.
Danke für den Hinweis. Leider gibt es keinen Podcast. Christian Brückner stelle ich mir schon für diese Lesung als (Fast-)Ideal vor.