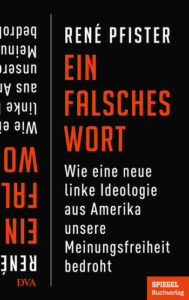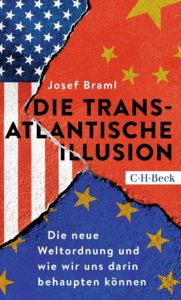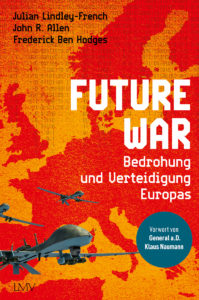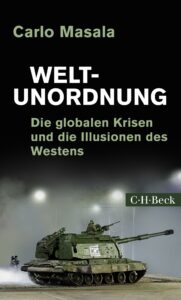
Weltunordnung
Die Publikationsgeschichte des Buchs »Weltunordnung« von Carlo Masala bestätigt indirekt die sich im Titel ausdrückende Feststellung. Die erste Auflage erschien 2016. Zwei Jahre danach eine aktualisierte Version. Und jetzt, 2022, nach der Invasion der Ukraine durch Russland, erscheint eine dritte, abermals aktualisierte und um ein Kapitel ergänzte Auflage. So werden Befunde des Autors belegt und noch vor kurzer Zeit für unmöglich gehaltene Entwicklungen werden plötzlich Realität.
Carlo Masala, 1968 geboren, ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch die militärische und geopolitische Kommentierung des Kriegs Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 bekannt. Sein Idealismus dem argumentativen Austausch gegenüber ist so groß, dass er sich bisweilen sogar ins Dilettantengetümmel der Polittalkshows stürzt. Wer sich dies ersparen möchte, kann immerhin noch dieses Buch lesen. Und es lohnt sich.
Die Arbeitshypothese ist schnell formuliert: Die Zeitenwende 1989/90 mit dem Zusammenbruch des bipolaren Systems (USA vs UdSSR bzw. NATO vs Warschauer Pakt) hat nach einem kurzzeitigen Honeymoon (»Ende der Geschichte«) zu einer veritablen weltpolitischen Unordnung geführt. Aber, so stellt Masala kühl fest: »Die Versuche der ‘westlichen’ Welt […] eine neue globale Ordnung zu schaffen, haben in einem nicht unerheblichen Maße dazu beigetragen, dass wir heute in einer Welt der Unordnung leben.« (»Westlich« wird hier natürlich nicht als geografische sondern als gesellschaftlich-kulturelle Zuordnung verstanden.) Daneben gibt es mit dem internationalen Terrorismus, Migrationsströmen, Cyberangriffen und Pandemien weitere Herausforderungen, die zur Destabilisierung führen.
In den 2000er Jahren wurde die »unilaterale Wende« der amerikanischen Sicherheits- und Außenpolitik durch eine seltsame Allianz aus Neokonservativen und liberalen Demokraten noch verstärkt. Die USA sahen »den Einsatz militärischer Machtmittel als legitimes Instrument […] um ihre globalen Phantasien zu realisieren«. Dabei sind alle Missionierungsversuche, die bisweilen unter dem Euphemismus der »humanitären Intervention« geframt wurden und Demokratie und freie Marktwirtschaft universalisieren sowie die » ‘westliche’ Vorherrschaft über den Rest der Welt« festschreiben sollten, gescheitert. Die Liste ist lang, reicht »von Bosnien-Herzegowina über Afghanistan und den Irak bis hin zu Libyen« (und ist damit noch nicht einmal vollständig). Resultat: Zerfallende Staaten oder bestenfalls eingefrorene Konflikte. Auch die gewaltsame Bekämpfung des islamischen Terrorismus ist nur teilweise gelungen.
Masala belegt dies an zahlreichen Beispielen, analysiert die Doppelmoral des Westens, der Demokratie predigt, aber beispielsweise »falsche« Wahlausgänge (wie in Algerien 1991/92 oder der Türkei 1996) sabotiert oder korrupte, aber ihm gewogene Präsidenten an die Macht hievt (wie in der Vergangenheit in Afghanistan). Schließlich verwirft Masala mit dem »Liberalismus« und der Verrechtlichung der Außen- bzw. Weltpolitik zwei Säulen des aktuellen politischen Denkens.