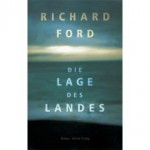
Die Lage des Landes
Frank Bascombe ist 55 Jahre alt und wir befinden uns im Interregnum des Jahres 2000, als Clinton fast nicht mehr, Gore wohl doch nicht und Bush auch noch nicht ganz sicher Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Wir folgen ihm drei Tage im November bis Thanksgiving (am Ende gibt es eine kleine Ausnahme, als ein kleiner Zeitsprung erfolgt).
Bascombe hat als Immobilienmakler an der Ostküste von den fetten Jahren der Clinton-Wirtschaftspolitik enorm profitiert. Ein bisschen stört ihn dieser Hype schon, der selbst für heruntergekommene Häuser sechsstellige Dollarsummen erzielt (Amerika ist ein Land, das sich in einem eigenen Treuhandkonto verloren hat.). Und ein bisschen verschanzt sich Bascombe auch hinter einer Maske (Reinlassen, aber nicht ganz einlassen).

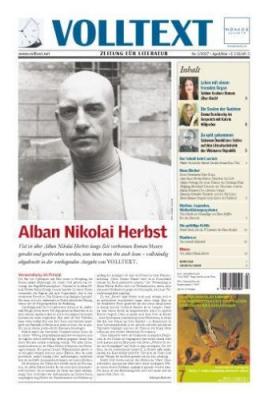

 Fast genau in der Mitte von Beim Häuten der Zwiebel fragt der Autor (und mit ihm der bis dahin geduldig gefolgte Leser): Was noch ist mir vom Krieg und aus der Zeit des Lagerlebens außer Episoden geblieben, die zu Anekdoten zusammengeschnurrt sind oder als wahre Geschichten variabel bleiben wollen? Eine schöne und treffende Charakterisierung des gesamten Buches. Dass es im vergangenen Sommer überhaupt einen derart grossen Furor auslöste, ist dem verstohlen auf Seite 126 wie beiläufig erwähnten Tatbestand geschuldet, mit dem Günter Grass seine Zugehörigkeit zu einer Einheit der Waffen-SS erwähnt (ja, erwähnt; nicht erzählt). Und weil dies bis Mitte August kaum jemand bemerkt hatte (die Kritiker hatten wohl so genau die Rezensionsexemplare nicht gelesen), kam es im berühmten
Fast genau in der Mitte von Beim Häuten der Zwiebel fragt der Autor (und mit ihm der bis dahin geduldig gefolgte Leser): Was noch ist mir vom Krieg und aus der Zeit des Lagerlebens außer Episoden geblieben, die zu Anekdoten zusammengeschnurrt sind oder als wahre Geschichten variabel bleiben wollen? Eine schöne und treffende Charakterisierung des gesamten Buches. Dass es im vergangenen Sommer überhaupt einen derart grossen Furor auslöste, ist dem verstohlen auf Seite 126 wie beiläufig erwähnten Tatbestand geschuldet, mit dem Günter Grass seine Zugehörigkeit zu einer Einheit der Waffen-SS erwähnt (ja, erwähnt; nicht erzählt). Und weil dies bis Mitte August kaum jemand bemerkt hatte (die Kritiker hatten wohl so genau die Rezensionsexemplare nicht gelesen), kam es im berühmten