
Andreas Maier: Das Zimmer



Da ich nun offensichtlich so oberflächlich die wenigen Ausgaben von »Volltext« gelesen habe, ist mir entgangen, dass dort Andreas Maier Kolumnen geschrieben hat. Vielleicht schreibt er dort noch immer Kolumnen. Jedenfalls sind nun dreiundzwanzig Kolumnen, die Andreas Maier von 2005 bis 2010 in »Volltext« geschrieben hat, in einem Büchlein erschienen. Es heißt »Onkel J.« und im Untertitel »Heimatkunde«. Es ist sehr schön, dass diese Kolumnen jetzt zusammengefasst erschienen sind.
»Die übergreifende Verbindungslinie von 1871 und 1990, also von nationaler Vereinigung und Wiedervereinigung, fand schließlich in Hamburg ihren sinnfälligen Ausdruck in Form eines ephemeren Denkmals besonderer Art: Ein ‘Kommando Heiner Geißler’ aus der autonom-alternativen Szene hatte des Nachts dem Bismarck-Denkmal von Lederer einen Helmut Kohl-Kopf übergestülpt und so die deutschen Einigungskanzler zur historischer Einheit verschmolzen.« Dieses Zitat stammt aus dem Aufsatz »Truppentriumph und Kaiserkult – Ephemere Inszenierungen in Hamburg« von Roland Jaeger aus dem Buch »Mo(nu)mente« (herausgegeben von Michael Diers). Jaeger nimmt Bezug auf ein wahres Ereignis: tatsächlich wurde anlässlich der Vereinigungsfeiern am 3. Oktober 1990 dem Kopf Bismarcks eine Helmut Kohl-Maske übergestülpt.
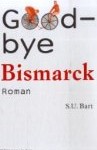
Josef Winkler, Büchnerpreisträger 2008, in Neuss
Nach der Lesung aus einem Buch »Roppongi« wurde Josef Winkler aus dem Publikum gefragt, ob er einen Grund nennen könne, warum so viele, eigentlich die meisten wortmächtigsten, zeitgenössischen Schriftsteller deutscher Sprache aus Österreich kommen würden (Handke, Jelinek, Thomas Bernhard und natürlich auch Winkler).
Winkler überlegte kaum, antwortete sehr schnell, anfangs mit einer Art Stottern oder, besser, Stammeln, als hätte er die Frage schon Wochen vorher gewusst. Naja, sagte er, es gäbe doch auch einige sehr gute Schriftsteller aus der Schweiz. Gelächter im Publikum. Dann hatte Winkler seine Gedanken sortiert. Handke, Jelinek, Bernhard – das seien europäische Ausnahmeerscheinungen. Insbesondere Handke.

John Banvilles »Die See« ist bei aller Melancholie und gelegentlichem Sentiment kein Bericht eines selbstmitleidigen Helden, der in den »besten Jahren« die obligatorische Sinnkrise bekommt.

Nach drei Jahren Gefängnis kommt Simon, jetzt 65 Jahre alt, in sein Dorf zurück – Schweizer Engadin; um 1935 (man muss die Zeit aus dem Erzählten rekonstruieren). Ein Jagdunfall, fahrlässige Tötung; viele Dörfler halten es für Mord. Und das ein Jahr nach der Auseinandersetzung im Dorf um die Jenischen, als sich Simon mit der Dorfnomenklatura angelegt hatte, die sie lieber heute als morgen aus dem Dorf wieder vertrieben hätten. Seine Frau ist während des Gefängnisaufenthalts verstorben – man hat es ihm nach der Beerdigung mitgeteilt.
Simon findet Unterkunft und Tagelohnarbeit; das Dorf ist hinsichtlich seiner Person gespalten. Seinen (unausgesprochenen) Wunsch, man möge diesen Unfall vergessen und sich an das erinnern, was er vorher für das Dorf geleistet hat, wird nicht erfüllt. Trotz der teilweise feindlichen Stimmung möchte er im Dorf – seiner Heimat – bleiben; eine (kurze) Beschäftigung im Hotel der nahegelegenen Stadt befriedigt ihn nicht. Er, Waldarbeiter Simon, der Einzelgänger, sucht das Dorf, die Gemeinschaft – und lehnt sie gleichzeitig ab. Hin- und hergerissen freundet er sich mit Vera an, die für sich und ihren Mann „sein“ Haus gekauft hat. Die dicke Theresa, die alles vom Dorf weiss, stört ihn aber bereits mit ihren Gewissheiten und Fakten.