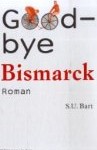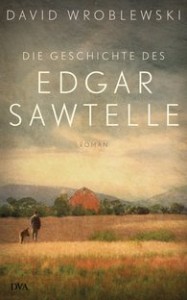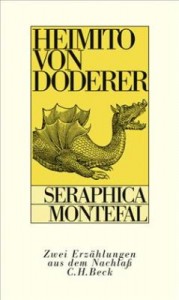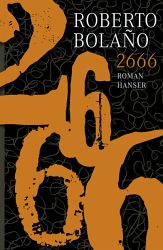
Das Buch beginnt so harmlos. Drei Literaturprofessoren (Jean-Claude Pelletier aus Frankreich, Manuel Espinoza aus Spanien und Piero Morini aus Italien) und die englische Literaturdozentin Liz Norton (später heißen sie nur noch die Kritiker) entwickeln über die Jahre eine Affinität zum Werk des deutschen Schriftstellers Benno von Archimboldi. Anfangs ein Geheimtip, forcieren nicht zuletzt die vier die Rezeption Archimboldis in der Literaturwissenschaft; unter anderem auch durch Übersetzungen. Auf Kongressen, Colloquien und andere Zusammentreffen (die es offensichtlich reichlich gibt) lernen sie sich persönlich kennen und vertiefen nicht nur ihre fachlichen Kenntnisse. Durch Liz Norton kommt es zu allerlei Liebesverwicklungen; die Dame hat zunächst Pelletier als Geliebten, etwas später dann Espinoza, längere Zeit beide parallel und mindestens einmal auch gleichzeitig. Die körperlichen Gebresten Morinis (er ist im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen) scheinen da Barrieren zu bilden, wobei es am Ende dieses ersten Teils dann doch noch eine Überraschung gibt.
Neben diesen Interaktionen unter den vier Kritikern (Telefon‑, Mail‑, Gesprächsaustausch), dem gelegentlichen Beäugen, den Idiosynkrasien, den Verletzungen, den Merkwürdigkeiten, den Sexualstellungen und –frequenzen – alles in einer Mischung zwischen Protokoll und Reportage aufbereitet – geht es natürlich auch um Literatur. Das Geschriebene bleibt die einzige Referenz für die Adepten, denn Archimboldi ist so phantomhaft wie im realen Leben sonst nur Thomas Pynchon.