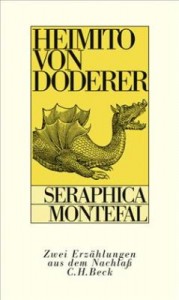
Heimito von Doderer: Seraphica – Montefal
Vieles spricht dafür, dass all dies für die beiden jetzt aus dem Nachlass von Heimito von Doderer veröffentlichten, in den 20er Jahren geschriebenen Erzählungen »Seraphica – Montefal« nicht gilt. Im außerordentlich klugen und kenntnisreichen Nachwort von Martin Brinkmann wird ein weiteres Motiv deutlich, welches wenigstens die Nichtveröffentlichung von »Seraphica (Franziscus von Assisi)« erklärt: In einer Zeit »unsicherer Zukunftsaussichten, schuldbeladener Sexualität und emotionaler Turbulenzen« bot sich ausgerechnet der heilige Franz von Assisi als »Identifikationsfigur« an. Durch die übermäßige Reinheit des Heiligen (»Willst Du vollkommen sein, so geh’ und verkaufe, was Du hast, und gib es den Armen, so wirst Du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach«), der sogar dem Feuer nicht wehetun will, obwohl es ihm die Kutte droht zu verbrennen wird das eigene, als verdorben empfundene Leben gespiegelt.
Brinkmanns durch die Tagebücher gestützte Erklärungen zeigen, dass sich Doderer hiermit seinen eigenen Lebenswandel sozusagen austreiben wollte (vermutlich vergeblich). Ob hier der Keim für die Jahrzehnte später vorgenommene Konversion zum Katholizismus zu sehen ist, bleibt offen. Bei nicht veröffentlichten Erzählungen scheint es notwendiger und legitimer zu sein, nach den privaten Hintergründen des Geschriebenen zu forschen.
»Seraphica« ist im Stil einer Legende geschrieben und umfasst Leben und Taten des Heiligen Franz von Assisi. Brinkmann betont die musikalisch-»prosarhythmische Durchbildung« der Erzählung. Doderer hat regelrecht recherchiert und die Original-Legenden über Franz von Assisi verwendet und bearbeitet. Die Schilderungen der guten Taten wirken auf den heutigen Leser in ihrer übermässigen Reinheit fast protestantisch-fundamentalistisch. Nur gelegentlich kommen philosophische Einsprengsel zum Vorschein, etwa wenn es faustisch heisst, dass diejenigen, welche von Wissensneugier geleitet sind…am Tage der Bedrängnis ihre Hände leer finden werden. Die virtuose Sprache Doderers lassen diese Art der fast übertrieben pointierten Erbauungsliteratur nicht in plumpen Predigerkitsch abgleiten; man sollte sich die Feinheit dieser Prosa unabhängig vom Sujet durch ein zweites Lesen erschliessen. Die einleitenden Ortsbeschreibungen, nein: Ortserzählungen zu Beginn sind ohnehin großartig und einfach wunderbar (in der Leseprobe sind sie glücklicherweise zugänglich).
Dennoch überstrahlt die persönliche Motivation des Autors Anfang/Mitte der 20er Jahre diese Erzählung fast über Gebühr. Literarisch zögert Brinkmann nicht, sie als »untypischstes aller Werke« von Heimito von Doderer einzuordnen und bemüht sich nach Kräften, Bedeutung zu erzeugen, in dem er zum Beispiel auf die Begriffe der Erkaltung und Erstarrung hinweist und diese im Kontext interpretiert.
Die zweite, kürzere bisher unveröffentlichte Erzählung »Montefal – eine avanture« (verfasst im Sommer 1922) bietet eine weitere Interpretation, warum sie vom Autor nicht publiziert wurde: Sie halt als eine Art »Vorfassung« des »Ritter-Romans« »Das letzte Abenteuer«, der 1936 niedergeschrieben wurde und 1953 erschien. Brinkmann zückt auch hier die autobiografische Karte (die bei Doderer naturgemäss auch später in den großen Roman immer wieder eine Rolle spielen wird) und erkennt eine resignative Lebenshaltung der Hauptfigur, des Ritters Ruy de Fanez, die er transformiert auf Doderers Zustand.
Den Ausgangspunkt zu »Montefal« sieht Brinkmann schon in einem kleinen Feuilletonbeitrag Doderers »mit dem auftrumpfenden Titel: ‘Der Abenteurer und sein Typus’ «. 1921 ist er nachweislich von einem Bild von Arnold Böcklin (»Der Abenteurer«) beeindruckt. In »Montefal« streift der spanische Ritter Ruy de Fanez, ohne Rast, kaum dreißig Jahre alt, mit seinem Ecuyer (Knappen) Gauvain durch die Gegend. Er kommt an einen Ort, an dem für die Erlegung eines Drachens die Hand der Herzogin Lidoine angeboten wird. Anfangs ein bisschen lustlos sieht er für sich endlich eine Art Lebenssinn aufflackern: Der Sinn des Spaniers stand zwar wenig nach einem festen Ehebunde und sesshaften Leben, sei es auch als Gemahl der Herzogin Lidoine und als Herrscher über ein ausgedehntes und fruchtbares Land; indessen schien ihm hier endlich das wahrhaft große Abenteuer gefunden, welches sein stets müderes und gleichwohl ruheloses Gemüt von Ende zu Ende vergebens gesucht hatte.
Ruy begegnet dem Drachen, tötet ihn aber nicht, sondern schlägt ihm nur ein Horn ab. Am Hofe wird er gefeiert und als zukünftiger Gemahl der Herzogin angesehen, obwohl der Drachen nicht getötet wurde. Mit sparsamen Mitteln aber schon gross aufblitzender Erzählkunst erzählt Doderer auf wenigen Seiten diese sich merkwürdig distanziert entwickelnde Beziehung zwischen Ruy und Lidoine. Die Angst vor Sesshaftigkeit von Ruy siegt letztlich über die Zuneigung zu Lidoine. Und als schließlich ein Neuankömmling (ein Deutscher!) am Hof auftaucht der tatsächlich den Drachen getötet haben will, und sich schnell als neuer Herr aufspielt, ritt [Ruy] eines Tages allein von dannen; selbst die Sprache in den Augen der Herzogin, als er den Abschied nahm, verstand er nun nicht mehr: ihr Mund aber blieb von Schmerz und Stolz versiegelt aber auch jetzt wird er nicht froh, denn [w]ie es denn geht, wenn Einer nach langem Schwanken das eine oder andere Teil freiwillig oder genötigt erwählt hat: sogleicht erscheinen ihm nur die Nachteile des erwählten Weges, den Vorteil aber sieht er ganz auf der anderen Seite...
Ruy muß ohne seinen Knappen auskommen, der in einem höfischen Turnier tödlich verletzt wurde. Er streift durch den Wald, begegnet erneut dem Drachen, der wider Erwarten noch immer lebt und tötet ihn mit Todesschweiß aus den Gliedern hervortretend endgültig. Am Ende erschrickt er über sein schlohweiße[s] Haar, lag noch etliche Tage in der Schenke auf einem Ruhebette und dachte an vieles bevor er in einen Haufen wilder Gesellen zu Pferde mit gezückten Schwertern hineinreitet.
Sehr anschaulich erläutert Martin Brinkmann den Unterschied zwischen der frühen Erzählung und dem »Letzten Abenteuer«, in dem sich beispielsweise die »Sympathiewerte…zu Ungunsten der Herzogin Lidoine verschieben« und, so Brinkmanns Übernahme der Deutung von Martin Mosebach, der Drachen »eher der Freund als der Feind des Ritters« zeige, weil er als »Prototyp des Antizivilisatorischen« gedeutet wird.
Ein kleines, aber feines Büchlein; nicht nur für »Heimitisten«.
Die kursiv gedruckten Passage sind Zitate aus den beiden Erzählungen von Heimito von Doderer; die Bemerkungen von Martin Brinkmann im Nachwort sind in Anführungszeichen gesetzt