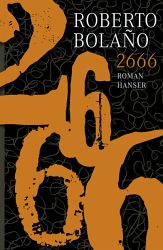
Das Buch beginnt so harmlos. Drei Literaturprofessoren (Jean-Claude Pelletier aus Frankreich, Manuel Espinoza aus Spanien und Piero Morini aus Italien) und die englische Literaturdozentin Liz Norton (später heißen sie nur noch die Kritiker) entwickeln über die Jahre eine Affinität zum Werk des deutschen Schriftstellers Benno von Archimboldi. Anfangs ein Geheimtip, forcieren nicht zuletzt die vier die Rezeption Archimboldis in der Literaturwissenschaft; unter anderem auch durch Übersetzungen. Auf Kongressen, Colloquien und andere Zusammentreffen (die es offensichtlich reichlich gibt) lernen sie sich persönlich kennen und vertiefen nicht nur ihre fachlichen Kenntnisse. Durch Liz Norton kommt es zu allerlei Liebesverwicklungen; die Dame hat zunächst Pelletier als Geliebten, etwas später dann Espinoza, längere Zeit beide parallel und mindestens einmal auch gleichzeitig. Die körperlichen Gebresten Morinis (er ist im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen) scheinen da Barrieren zu bilden, wobei es am Ende dieses ersten Teils dann doch noch eine Überraschung gibt.
Neben diesen Interaktionen unter den vier Kritikern (Telefon‑, Mail‑, Gesprächsaustausch), dem gelegentlichen Beäugen, den Idiosynkrasien, den Verletzungen, den Merkwürdigkeiten, den Sexualstellungen und –frequenzen – alles in einer Mischung zwischen Protokoll und Reportage aufbereitet – geht es natürlich auch um Literatur. Das Geschriebene bleibt die einzige Referenz für die Adepten, denn Archimboldi ist so phantomhaft wie im realen Leben sonst nur Thomas Pynchon. Seine Manuskripte kommen aus Italien oder Griechenland und einzig die greise Verlegerin Anna Bubis kennt ihn persönlich (man erfährt dazu im Laufe des Buches mehr). Außer Bubis gibt es selbst im Verlag (der teilweise dem Fischer-Verlag nachempfunden ist), den die Kritiker auch besuchen, keine Spur und außer der Chefin auch niemanden, der nachweislich mit Archimboldi jemals kommuniziert hat. Man weiß nur, dass er hager und sehr groß ist und blonde Haare gehabt haben soll. Nicht ein Bild existiert; an der Stelle auf der Wand der Verlegerin, an die sie sich erinnern, einen großen, hageren Mann mit ihr gesehen zu haben, war am nächsten Tag eine weiße Stelle.
Ab und an findet sich dann doch ein Zeuge, beispielsweise derjenige, der den Schriftsteller 1959 bei einer Lesung im Friesischen kennengelernt (eher: gesehen) haben will. Und sie hängen an den Lippen dieses Mannes, dessen Bericht förmlich aufgesaugt wird (Bolaño braucht dazu nur einen Satz – der allerdings sechs Seiten umfasst und von Friesland bis nach Buenos Aires führt). Als Archimboldi Ende der 90er Jahre mehrmals als Nobelpreiskandidat gehandelt wird, steigt der Unternehmungsgeist der Kritiker den greisen Dichter (der 1920 in »Preußen« geboren wurde und Hans Reiter heißt – viel mehr biografische Informationen besitzen sie nicht) zu treffen, ihn zu interviewen und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen (obwohl die Zeiten der großen Erfolglosigkeit des Dichters offensichtlich vorbei sind, denn einmal, als die Beschäftigung der Vier mit ihrem Helden kurz nachließ, wird bemerkt, dass dessen Ansehen hinter ihrem Rücken wuchs).
Von der Burleske zu »Twin Peaks«
Dabei werden nicht nur die (lächerlich erscheinenden) Hahnenkämpfe innerhalb der Germanistenzunft süffisant ausgebreitet (die Archimboldi-Anhänger teilen sich in zwei Lager, die sich anfangs unversöhnlich gegenüberstehen) sondern auch die Ambitionen der Vier, innerhalb der Kritikerkaste mit einer Sensation reüssieren zu wollen. Und als es ein vages Gerücht gibt, Archimboldi befinde sich in einer amerikanisch-mexikanischen Grenzstadt machen sich drei der vier (der Italiener bleibt zu Hause) nach Santa Teresa auf, diesem (fiktiven) Ort, der – wie man hört – durch eine enorme Serie von Frauenmorden seit Jahren auch überregional Schlagzeilen macht. Dort treffen sie Professor Amalfitano, der dort mit ihnen nach Hans Reiter recherchiert (man sucht alle Hotels nach einem Deutschen ab).
Mit der Ankunft der Europäer in Mexiko kippt die Atmosphäre des Romans, der bis dahin eine eher heiter-ironische Burleske auf den europäischen Literaturbetrieb war. Auf den letzten rund 80 Seiten des ersten »Buches« (von insgesamt 200 Seiten) reift ein unterschwellig waberndes Bedrohungsszenario heran, welches im weiteren Verlauf ständig gesteigert wird, ein Gefühl der Unwirklichkeit auch beim Leser auslöst und im vierten Teil in einen großen apokalyptischen Strom kumuliert.
Die Ermittlungen in Santa Teresa bleiben erfolglos; Reiter bleibt unauffindbar, wobei immer Zweifel bleiben, ob er jemals angekommen sein soll (eine Umweg-Parallele zur Unwissenheit des Lesers des Buches, der nie in den Genuß auch nur eines Archimboldi-Satzes kommt). Eine trübe Stimmung macht sich unter den Kritikern breit; Norton fliegt zurück (und landet in Italien bei Morini). Espinoza bändelt unterdessen mit einer sehr jungen Teppichverkäuferin an während Pelletier in der Hotellobby die Romane von Archimboldi zum wiederholten Mal liest. Amalfitano ist großen Stimmungsschwankungen unterworfen, manchmal seltsam fahrig, dann wieder der perfekte Gastgeber, was zu den wildesten Spekulationen Anlaß gibt.
Über Amalfitano handelt dann der zweite Teil (mit knapp 80 Seiten das kürzeste Kapitel). Er kommt eigentlich aus Spanien und ihn hat es durch letztlich ungenannte Umstände nach Mexiko verschlagen. Seine Frau geht eines Tages aus dem Haus und lässt ihn mit der kleinen Tochter alleine. Jahre später kehrt sie kurz wieder zurück, hat in Frankreich ein weiteres Kind bekommen. Sie hat AIDS und verlässt Amalfitano nach kurzer Zeit wieder. Privat gescheitert und mit dem Gefühl des verkannten Intellektuellen wird er immer schrulliger. Seine Vorträge an der Universität werden fast unverständlich. Eines Tages hört er eine Stimme, die er mal für den Großvater, dann wieder für den Vater hält; er wird wahnsinnig, glaubt aber, den Wahnsinn beherrschen zu können, wenn er ihn als solchen annimmt. Derweil taucht seine Tochter Rosa in der Jugendszene von Santa Teresa immer weiter ein.
Der dritte Teil handelt von dem schwarzen amerikanischen Kulturreporter Quincy Williams (der merkwürdigerweise Oskar Fate genannt wird). Fates Mutter ist gestorben und durch die Ermordung des Kollegen, der sich mit dem Boxen beschäftigt, wird er von seiner Redaktion gebeten eine Sportreportage über einen Boxkampf zu machen, der in Santa Teresa stattfindet (ein Kampf zwischen einem amerikanischen und einem mexikanischen Boxer – eine verkrampfte Allegorie auf das ambivalente Verhältnis zwischen den USA und Mexiko). Durch Gespräche mit Einheimischen und lokale Berichte wird Fate auf die Mordserie aufmerksam. Der Boxkampf bringt den erwarteten Sieger (Fate trifft am Ring Rosa Amalfitano, die ihn fasziniert). Er bittet seine Redaktion, über die Mordserie berichten zu dürfen, was jedoch abgelehnt wird, da kein Interesse daran bestünde. Gegen Ende verbündet er sich halbherzig mit einer Journalistin und besucht mit ihr den Hauptverdächtigen der Morde im Gefängnis. Es ist Klaus Haas, ein großer, blonder Mann, ein Deutscher, der die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, seit Jahren auf die Wiederaufnahme seines Verfahrens wartet (seit seiner Inhaftierung ging die Mordserie unvermindert weiter) und Pressekonferenzen aus dem Gefängnis heraus mit dem Handy organisiert und in der Gefängnishierarchie sehr schnell zur Führungsfigur aufsteigt.
Einhundertvier Ermordete auf dreihundertzweiundvierzig Seiten
Der vierte Teil beginnt im Jahr 1993 (endet Ende 1997) und listet litaneiartig die teilweise fürchterlich entstellten Leichenfunde auf. Es sind einhundertvier tote Frauen (vom zehnjährigen Kind bis zur reifen Ehefrau) auf dreihundertzweiundvierzig Seiten. Trotz diverser Exkurse, beispielsweise über einen vermutlich sakrophobischen Kirchenschänder, der unterschiedlichen Charaktere der Gerichtsmediziner von Santa Teresa, den Frauenwitzen der Polizei, einem Snuff-Video-Ring (der dann doch nicht zu existieren scheint) und dem Besuch eines amerikanischen Profilers, der die örtliche Polizei unterstützen soll – unweigerlich beginnt der durch Lektüre und entsprechende Filme konditionierte Leser kriminalistische Überlegungen, sucht nach einem Schema, nach Gemeinsamkeiten, kurz: er betätigt sich als Amateurkommissar, folgt den Spuren, entwickelt Theorien, versucht, »Täterprofile« zu phantasieren. Dies alles bleibt jedoch fruchtlos; das Buch verweigert sich jeder Aufklärung. Zu unterschiedlich die Art und Weisen der Ermordungen (auch hier werden stets alle Einzelheiten ausgebreitet – vom Verwesungszustand bis zum Interesse der medizinischen Fakultät von Santa Teresa an dem Leichnam). Und zu verschieden die Opferprofile, obwohl es meist Arbeiterinnen aus den im Umland befindlichen Billiglohnfabriken sind.
Die Polizei ist überfordert, aber auch desinteressiert. Die Fälle werden häufig sehr schnell ad acta gelegt; Spurensicherung am Tatort ist meist ein Fremdwort und gibt es Spuren, die weiter verfolgt werden müssen, dann versagt merkwürdigerweise oft Kommunikationswege oder es gibt wider Erwarten kein Resultat. Als einige Opfer vorher in einem bestimmten Fahrzeugtyp (»Peregrino«) einsteigend gesehen wurden, werden die Ermittlungen in dem Moment eingestellt, als die Polizisten sich bei einigen dicken Fischen unbeliebt gemacht hatten, deren Söhne, die Jeunesse dorée von Santa Teresa, nahezu die gesamte Peregrino-Flotte der Stadt besaßen.
So sind die Kommissare desillusioniert oder korrupt oder beides (früh wird der potentielle »Nachwuchs« auf das bestehende System vergattert). Der Polizeichef wird mit dem amerikanischen Konsul, dem Bürgermeister und mit Personen, die als Drogenbosse verdächtigt werden, bei Festen oder Zusammenkünften gesehen. Offiziell gilt die Mordserie mit der Verhaftung von Klaus Haas als abgeschlossen, obwohl sie weitergeht. Später nimmt man noch eine andere Gruppe fest – mit ähnlichem Resultat. Haas beschuldigt aus dem Gefängnis heraus in einer Pressekonferenz eine in der Stadt hoch angesehene Familie der Morde, aber niemand glaubt ihm.
Von der Unmöglichkeit, zu weinen
Nur einer ragt da heraus: Der Mittdreissiger Juan de Dios Martínez. Er sichert noch gewissenhaft Spuren. Wo andere fünf Stunden brauchen um an den Tatort zu kommen, ist er in einer Stunde da. Er sucht und befragt Zeugen und er klärt Fälle auf (allerdings nur diejenigen, die nichts mit dem/den Serienmördern zu tun haben; auf die anderen wird er irgendwann gar nicht mehr angesetzt). Martínez ist die Kerze in diesem Panoptikum der Düsternis. Er hat ein Verhältnis mit einer rund fünfzehn Jahre älteren Ärztin und Leiterin einer Irrenanstalt, die er bei den Ermittlungen zum Kirchenschänder kennen- und liebenlernt. Die wohlhabende und gebildete Frau, die sich Martínez alle vierzehn Tage in ihrer Wohnung in einem festen Ritual hingibt, will einerseits diesen Ort verlassen und sich in Europa neu etablieren – ist aber andererseits dazu nicht in der Lage.
Es sind diese Szenen der Kontemplation (hier bleiben uns auch schlüpfrige Details aus der Zusammenkunft der beiden erspart), die dann aus dem Nachrichtenton und im Strudel der immer dichter werdenden Endzeitstimmung herausragen und diesen Teil des Romans zum lesenswertesten machen. So sitzt Martínez einmal im Auto, lehnte den Kopf an den Lenker und versuchte zu weinen, was ihm nicht gelang. Ein andermal geht ihm ein Fall so nahe, dass er den Kopf in die Hände vergrub und seinen Lippen entschlüpfte ein schwaches, deutliches Jaulen, als würde er weinen oder mit den Tränen kämpfen, aber wenn er schließlich die Hände wieder sinken ließ, kam nur seine alte, von der Mattscheibe erleuchtete Visage zum Vorschein, seine alte, unfruchtbare, trockene Haut, und nicht die Spur einer Träne. Er, der die Menschheit in diesem Moment noch retten könnte, vermag nicht mehr zu weinen.
Das letzte »Buch« erzählt, nein: berichtet das Leben von Hans Reiter (alias Benno von Archimboldi (die Nähe zum italienischen Renaissance-Maler ist, so wird berichtet, durchaus gewollt). Obwohl 1920 geboren, erscheint Reiters Kindheit eher im 19. Jahrhundert angesiedelt zu sein. Die Kriegserzählungen – personal und ohne jede Empathie erzählt – zeigen einen somnambul-todesmutig taumelnden Soldaten Reiter (bei allen großen Unterschieden ist hier eine Parallele zu Ernst Jünger), der sich häufig furchtlos den gegnerischem Feuer entgegenstellt. Danach flacht dieses Kapitel zusehens ab. Die Irrungen, Wirrungen und später dann auch Vögeleien sind von aufreizender Langeweile. Reiter/Archimboldi entwickelt solipsistische Züge. Man erfährt noch, dass Klaus Haas, der Gefangene in Santa Teresa, der Sohn von Reiters Schwester ist. Als diese nicht mehr weiterweiß, bittet sie ihren zehn Jahre älteren Bruder, zu intervenieren. Und mit dem letzten Satz es Buches fliegt Reiter dann nach Mexiko.
Und doch gibt es hier mächtige Szenen wie beispielsweise der Kontrast zum vergeblichen Trauernden Martínez, der sich in Reiters Kindheit zeigt, als der sechsjährige plötzlich unter Wasser vor Glück weint. Oder der 25jährige, dem Krieg gerade entronnen, der in einem Kleiderladen bei der Vergegenwärtigung des scheinbar baldigen Todes seiner Geliebten unmittelbar das stumme Weinen beginnt und dann das Fliessen der Tränen einsetzt.
So muss wohl irgendwann zwischen 1950 und 1993 die Hoffnung für die Menschheit verloren gegangen sein. Santa Teresa ist der Ausgangspunkt dieser umfassenden Trostlosigkeit, die, präziser gesagt, eine Ent-Tröstung ist. Die letzten Tage der Menschheit im vermeintlichen Frieden. Santa Teresa als Hauptstadt der Vergeblichkeit. Obwohl die einzelnen Kapitel einigermaßen feste Zeitrahmen haben (1994–1998/99; ab 1998; ab 2002; 1993–1997; 1920–2001) sind sie Projektionen an eine Zukunft, die sich im Blick auf Santa Teresas Vergangenheit und Gegenwart formt und den Globus überziehen wird.
Wie beiläufig dann eine Art von Lösung, in der Reiter mitten im Russlandkrieg einen Glücksmoment erlebt, der ihn so frei wie noch nie in seinem Leben macht: Die Möglichkeit…, dass alles nur ein Trugbild sein könnte, beschäftigte ihn. Das Trugbild war eine Besatzungsmacht der Wirklichkeit, dachte er, die noch die äußersten und entlegensten Bereiche der Wirklichkeit kontrollierte. Es lebte in den Seelen der Leute und in ihren Gebärden, in ihrem Willen und im Schmerz, in der Art, wie einer seine Erinnerungen ordnete, und in der Art, wie er Prioritäten setzte. Das Trugbild blühte in den Salons der Industriellen und in der Unterwelt. Und natürlich ist der Nationalsozialismus das zu absoluter Herrschaft gelangte Trugbild. Aber auch Liebe sei im Allgemeinen auch nur ein Trugbild…die Liebe, die Partnerliebe mit Frühstück und Abendessen mit Eifersucht und Geld und Traurigkeit, ist Theater, also Trugbild.
Spinnt man diesen Gedanken weiter, so scheint dann auch das Trugbild des Humanismus an einem Ort wie Santa Teresa wie bei einer archäologischen Ausgrabung als Relikt der Vergangenheit freigelegt zu werden (oft erinnern die Leichenfunde an archäologische Objekte; auch was die Bergung angeht).
Hochambitionierte Verrätselungen
»Manischer Realismus« wird Bolaño mit diesem Buch nachgesagt. Eine ebenso zutreffende wie unvollständige Charakterisierung. Das Manische zeigt sich vor allem in den schier unerschöpflichen Schilderungen der geschundenen, missbrauchten, verstümmelten Leichen. Und Bolaño erwähnt Kafka viel zu häufig, um nicht eine Art Fortschreibung der Kafka-Halb- und Zwischenwelten angestrebt zu haben; er kopiert seinen Ton manchmal bis fast zur Paraphrase. Hinzu kommen die philosophischen Fingerübungen, die nur manchmal überzeugen und unzählige Allegorien, Anspielungen und Nebelkerzen, die mit scheinbar diebischem Vergnügen eingebaut wurden. Im Kapitel über Archimboldi scheut er sogar nicht davor zurück, einen von den eigenen Soldaten ermordeten rumänischen General als Gekreuzigten (mit grossem Gemächt, dessen Aktion Reiter Jahre zuvor beobachtete, als dieser eine Frau damit penetrierte, die später Anne Bubis wurde) zu inszenieren.
Oder man taucht in zahllose Binnenerzählungen ein und in den Binnenerzählungen erscheinen weitere Binnenerzählungen, die jedoch in den meisten Fällen ins Nichts führen und nie mehr aufgegriffen werden. Das sind dann irgendwann zu viele fruchtlose Verirrungen. Dieses so bemüht wirkende Scharadentum (von Ferne an David Lynchs Fernsehserie »Twin Peaks« erinnernd oder auch – in seiner Episodenhaftigkeit und Staffelübergabe der Handlung an den »nächsten« Protagonisten – an Jacques Rivettes cineastisches Opus Magnum »Out 1 – Noli me tangere«) bleibt meist flache Imitation eines pseudo-geheimnisvollen Existentialismussurrogats oder einfach nur Spielwiese für philologische Sinnsucher, die hinter jedem Gebüsch eine Legion böser Geister vermuten.
Alles wird dieser Verrätselung untergeordnet. Es beginnt schon mit dem merkwürdigen Titel des Buches. So wird berichtet, Bolaño habe selber, kurz vor seinem Tod, 2666 als eine Art Endzeitjahr genannt. Zahlenmystiker entdecken hierin ein 2 Mal 666 – die Zahl der Apokalypse aus der Offenbarung Johannes. Wieder andere ziehen Verweise aus anderen Bolaño-Romanen heran und erklären den Titel damit. Oder wurde beim Schreiben zu schnell getippt – statt »»666«« blieb »2666«. Man könnte auch auf die Idee kommen, Bolaño paraphrasiere Kubricks »2001« und transformiert die Odyssee im Weltraum auf die Erde.
Aber während Kafkas Welt ein Überall-Ort in einer Überall-Welt sein kann, bleibt Santa Teresa im Buch Santa Teresa im Jahr 1993 bis 2002 (auf die tatsächlichen Parallelen zum mexikanischen Grenzort Ciudad Juárez und der dortigen Frauenmordserie wird im kurzen Nachwort von Ignacio Echevarría verwiesen). Der große Fehler dieses überdimensionierten Romans ist, dass dem Leser die Möglichkeit der Distanzierung zu einfach gemacht wird. In postmoderner Gemütlichkeit kann man sich jederzeit problemlos aus dem Roman flüchten und die Protokollperspektive des Erzählers annehmen. Man liest dann bestenfalls eine Reportage; die Sprache ist stumpf. Zu sehr scheint sich Bolaño auf Effekte und Affekte zu verlassen (zudem lässt das letzte Kapitel erahnen, dass der Autor es nicht mehr fertigstellen konnte). Das Buch – und selbst dieses abscheuliche Kapitel der Verbrechen – packt den Leser nicht. Zu selten wird eine Intensität erreicht, die berührt. Fülle und Fluktuation des Personals, welches insbesondere in den direkten Santa-Teresa-Kapiteln (letztes Drittel des 1., Kapitel 2–4) ausgebreitet wird, lassen Empathie mit oder gegen die Figuren nicht oder kaum zu (Ausnahme ist die bereits erwähnte Figur des Kommissars). Was den Leser bestenfalls bei der Stange hält ist Neugier auf das Exotische oder vielleicht eine fortlaufende Entrüstung.
Wie aufdringlich die intertextuellen Rekurse eingearbeitet sind. Von Thomas Manns Todesstadt Venedig über den lateinamerikanischen magischen Realismus, den Satzschrauben eines Thomas Bernhard, Doris Lessings »Memoiren einer Überlebenden«, der moralischen Verkommenheit der Protagonisten aus Hubert Selbys »Letzte Ausfahrt Brooklyn« bis zu Nuancen aus Brent Easton Ellis’ psychopathischen Massenmörder »Bateman« aus »American Psycho« – um nur einige wenige anzugeben.
Somit ist dieses Buch für Literaturexegeten ein schier unerschöpflicher Steinbruch. Sie überschlagen sich daher auch folgerichtig mit Lob für dieses monströse Stück Literatur-Literatur, weil sie in mit Querverweisen ihr literarisches, cineastisches, kunsthistorisches, dramatisches und/oder historisches Wissen verwursten und mit immer neuen Assoziationsgewittern brillieren können, die am Ende so richtig wie falsch sind und kaum Erkenntnisgewinn bringen. Als wäre dieses Behaupten von Authentizität, welches in diesem Buch praktiziert wird, schon Ausweis für Qualität. Freilich, den blutleeren Schreibschulliteraturen, die die Kritik so oft und so voreilig in den Literaturhimmel hebt (teils aus Angst, sich mit wirklichen Talenten auseinanderzusetzen, teils aufgrund ästhetischer Rostspuren in ihrem Getriebe), ist dieser Roman natürlich meilenweit überlegen. Aber es bleibt ein irgendwie potemkinscher Roman: hinter den Fassaden sitzen nur die Deuter. Glauben Sie ihnen kein Wort, denn sie projizieren nur ihren eigenen Roman in dieses Buch. Tatsächlich macht die Lektüre von »2666« nicht einmal unglücklich. Sondern nur apathisch.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

Alles Scheitern?
Trotzdem: von den beiden Über-Romanen dieses Herbsts – der andere also „infinite jest“ – hatte ich mir unwillkürlich diesen ausgesucht. Ich müsste länger ausholen, um zu sagen, warum. Das Unabgeschlossene dabei (von dem ich also schon gehört hatte), das Monomanische und sogar das „Scheitern“ (das auch schon mehrfach konstatiert wurde) – all das hat mich trotzdem sehr neugierig gemacht. Ich bin sonst nicht wild auf diese Über-Versuche der Literatur: »Das große Werk« – gut und schön, aber diese Zeit scheint auch mir irgendwie abgelaufen. (Gestern in einem – lesenswerten! – Artikel in der SZ über Rainald Götz: „Ein heutiger Proust klänge zwangsläufig wie Cosmopolitan, heißt es in seinem Buch »Klage« einmal...“)
Bin nun aber doch gespannt auf Bolano. Und auch, ob ich ähnlich empfinden werde, wie Sie!
Tja, Scheitern...
mag ja vielleicht stimmen. Aber hierfür müsste man die Ambition kennen – und die erschließt sich mir nicht (außer die Vergeblichkeit aufzuzeigen, die Welt »abzubilden« – naja).
Natürlich würde mich Ihre Meinung zum Bolano brennend interessieren. (Allerdings ist das Buch – meiner Meinung – keines, das man im Herbst oder Winter lesen sollte.)
–
Zu Goetz sag ich lieber nichts. Dass die deutsche Feuilleton-Journaille diesen Kerl derart ins Rampenlicht stellt sagt sehr viel über sie aus.
Mmm. Das würde mich jetzt aber sehr interessieren
was Ihre Kritik an Götz ist. Muss nicht erschöpfend sein, nur das Wesentliche würde mir schon mal reichen.
Er ist sicher kein Literat in herkömmlichen Sinne, und seinen »fiktionalen« Bücher – wenn man sie überhaupt so nennen darf – fand ich auch nicht alle wirklich überzeugend. Aber als genauer Beobachter, und von daher starke Wirkfigur doch von einer ursprünglichen, empathischen verstandenen Literatur her, finde ich ihn doch sehr interessant – und vor allem fast immer lesenwert.
(Dass ich dazu seine Urteile nicht teilen muss, ist klar. Aber allein seine Antipodenhaltung zu Handke und Strauß ist so fruchtbar... da steckt noch viel drin. Insofern fand ich den SZ Artikel so interessant.)
Goetz...
kann ich nicht Ernst nehmen. Sein »Abfall für Alle« war ja ganz nett, aber mehr auch nicht. Das machen tatsächlich viele Blogger durchaus besser...über etwas herziehen, über das sie nur marginale Ahnung (oder Empathie) haben (oder diese nur behaupten). Er ist ein bisschen ein Krawallrabaucke, der Jeff Koons mag und aus dieser Spannung für die Feuilletonisten interessant ist. Außerdem ist er jetzt 50 und als Suhrlkamp-Autor damit reif für das virtuelle FAZ/SZ/FR/ZEIT-Wachsfigurenkabinett. Und sich an Handke und Botho Strauß abzuarbeiten macht heute jeder Depp; die darf man doch längst anpinkeln, um dann zum Jet-Set zu gehören. Das ist so originell, wie auf dem Marktplatz einen Keks zu essen. (Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht.)
Ihre Kritik an »2666« lässt sich auch als allgemeine methodische Kritik an derlei postmodernen Über-Werken lesen. Das gibt es leider nur allzu selten, häufig weil man meint, sich im künsterlischen Metier derartiges nicht erlauben zu dürfen. Jedenfalls lassen sich viele Kritikpunkte fast übergangslos auf »Infinite Jest« etc. übertragen.
Ich hatte mir gestern die Aufzeichnung des letzten »Literaturclub« (mit Iris Radisch) angesehen, in dem »Unendlicher Spaß« besprochen wurde (der Übersetzer wurde mit in die Diskussion eingebunden). Tatsächlich entdeckte ich einige Gemeinsamkeiten, auch wenn die Bücher sicherlich sprachlich vollkommen verschieden sind (von der Handlung erst gar nicht zu reden). Aber auch hier wurde das Überdimensionierte herangezogen – insbesondere was wohl seitenlange lexikalische Einwürfe angeht. Teilweise attestierte man sogar Unverständlichkeit. Schließlich die Parallele mit der wohl eher deprimierenden Lektüre (wobei man das Buch offensichtlich nicht lesen kann ohne auf das Ende des Autors zu blicken – was fatal sein dürfte).
Vielleicht haben Sie ja Recht. Obwohl ich nichts gegen postmoderne »Über-Werke« hätte, wenn sie nicht ständig dieses »Über-Werkliche« (mir fällt kein besseres Wort ein) auch noch derart maniriert herausstellen wollten, sträubt sich doch etwas in mir, diese »Welterklärungsliteratur« immer wieder vorangekündigt zu bekommen. Sei es durch die exaltierte Ambitioniertheit des Autors oder durch die (plumpe) Werbung des Verlags (oder beides).
Und brav soll der Leser all dem folgen, am besten seinen Verstand an der Garderobe abgeben, sein leserisches Rüstzeug aus dem Schrank holen – und beginnen, damit zu spielen. Da erlaube ich mir dann ein bisschen den Spielverderber abzugeben. Und eigentlich kommt für mich Dichtung auch von »Verdichtung« und nicht »Ausuferung«.
(Haben Sie den Wallace gelesen? Wie?)
Ich hatte mit dem Buch geliebäugelt, war aber durch die PR etwas irritiert. Als ich dann las, dass der Lebenslauf des Autors auch nur Prosa ist (wer glaubt die aufgeschobene Lebertransplantation, um das Buch zu Ende zu schreiben), nahm ich dann erstmal Abstand. Zu viele Seiten für eine Enttäuschung, was ich hier dann ja bestätigt finde.
P.S. Der Titel bezieht sich wohl auf einen Friedhof aus dem Jahre »2666« aus dem Buch »Die Wilden Detektiven«.
@Peter42
Andreas Isenschmid präferiert in seiner Stellungnahme die Version vom doppelten »666«... Auch er, der Bolano wohl auch von anderen Büchern kennt, steht diesem Buch skeptisch gegenüber.
Vielleicht ist es ja immer so, dass man das haben möchte, was man noch nicht gehabt hat: Ich hätte vermutlich lieber den Wallace gelesen (ist bei mir derzeit zeitlich nicht möglich).
@en-passant / zu Goetz
Lese gerade »Loslabern«. Ich muss mich vermutlich nicht vollständig korrigieren. Aber manche Stellen sind mehr als nur amüsant.
(Demnächst hier mehr.)
Zwei Herren der Literaturschickeria lesen zwei Bücher
@Keuschnig
@Peter42
Die Bemerkung über die Lebertransplantation ist, wenn auch nur zitiert, geschmacklos. Zwei Literaturbeflissene gefallen sich darin, zwei Bücher zu verreißen. Bolano liest man mal eben so in zwei Wochen, dann zieht die Karawane weiter, wohin? Zum nächsten Verriss? Selbstsonnend gerecht? Sie sind zu schnell, meine Herren, n´allez pa trop vite, um mit Proust zu sprechen. Ihnen entgehen die Einzelheiten, aber auch auf sie läßt die Sonne einen letzten, flüchtigen Lichtstrahl scheinen und in dem ihm folgenden, dahinfließenden Schatten genießt sie ihr eigenes Schweigen.
@Dietmar Hillebrandt
Hoffentlich lesen Sie normalerweise genauer. Erstens steht die Bemerkung über die Lebertransplantation in einem Kommentar und nicht in der Besprechung. Zudem kann man darüber streiten, ob es vom Verlag geschmackvoll ist, diese Legende auszubreiten. Und zweitens habe ich keinen »Verriss« geschrieben – das zeigt dann auch, dass sie nicht oder nur sehr ungenau lesen.
Und dann das hier: Ein fünfseitiger Satz war mir einfach zu lang und erschien mir manieriert. Jemand, der solch einen Satz schreibt, verteilt Haltungsnoten in Literaturkritik? Lachhaft!
Lange Sätze
Nun seien sie mal nicht so beleidigt, Herr Keuschnig. Wenn Sie mich weiter zitiert hätten, wofür ich Ihnen übrigens danke, dann hätten Sie bei genauerem Lesen gefunden: »Mittlerweile sehe ich das etwas anders... Heute würde ich sagen, vielleicht ist das Bolanos Art, eine Reminiszenz oder Referenz auf Proust zu hinterlassen. Aber auch das ist nur Vermutung. Haltungsnoten vergebe ich keine, da ich selbst lebertransplantiert bin, fühlte ich mich von dieser Bemerkung verletzt. Deshalb wohl meine Polemik...
@Dietmar Hillebrandt
Ich bin nicht beleidigt. Was ich aber nicht mag, ist, die Marketingstrategie des Verlages nicht befragen zu dürfen. Ich halte diese Angabe des Verlags (oder diese Vermutung) für vollkommen uninteressant, was die Rezeption des Buches angeht.
Vor ein paar Monaten, war ich mal wieder in einem dieser, andernorts Bücherpuff genannten, Läden, die schön nach den Sparten Krimi, Frauenbücher und Esoterik Tische mit den aktuellen Bestsellern drapieren. Auf einem dieser Tische lag erstaunlicherweise (spät nach dem medialen Hype) die Taschenbuchausgabe von 2666 und rief leise Kauf mich. Mit einem Du bist zu dick versuchte ich mich zu wehren, verlor aber schließlich und hatte noch dazu den neuen Vargas Llosa in der Tasche.
Von den ersten, tatsächlich harmlosen Seiten, bis zum Abflug Archimboldis nach Mexiko war ich mir nie ganz sicher, ob ich gerade ein Meisterwerk lese oder nur einer Chimäre aufsitze. Mit jedem Tag danach wurde ich aber sicherer das qua Wirkung ersteres der Fall ist und das vielfach verwendete »monströs« die einzig adäquate Vokabel ist, um die Gesamtschau der fünf Teile zu beschreiben. Die vielen losen Fäden, die man versucht zu verknüpfen, die vielen, teils genialen Binnengeschichten ergeben ein faszinierendes, schier unlösbares Geflecht. Ob das jetzt Absicht oder Willkür ist, sei dahin gestellt.
Besonders auffällig ist der völlig unterschiedliche Duktus, in dem die einzelnen Teile gehalten sind. Die anscheinend nüchterne Auflistung der Todesfälle im vierten Teil fand bei den meisten Lesern die größte Ablehnung. Beim Lesen drängte sich schnell eine Analogie barocker Musik auf, bei der die Morde dem Basso continuo einer Passacaglia oder Chaconne gleich, die (makabere) Begleitung für das Geflecht der Oberstimmen, die immer wieder im Kontrapunkt stehen, bilden. Die nackte Aufzählung zu monieren, ist damit unnötig, da sie nur das Gerüst bildet, auf dem sich die eigentliche Handlung abspielt. Diesen Teil habe ich zumindest als den stärksten Teil des Romans empfunden.
Die musikalische Analogie weiter gesponnen, könnte man die fünf Teile vielleicht mit den charakteristisch verschiedenen Sätzen einer Sinfonie vergleichen, was aber wahrscheinlich zu weit führt. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Der Vargas Llosa dagegen war nur langweilig.
@Peter
Sehr schöne Beschreibung des Leseerlebnisses. Vielen Dank für diese Bereicherung.