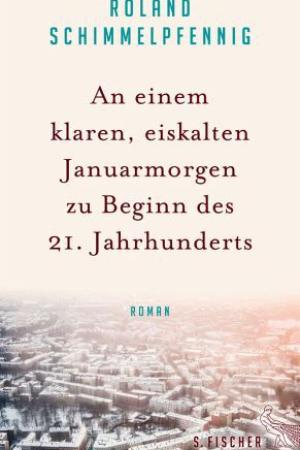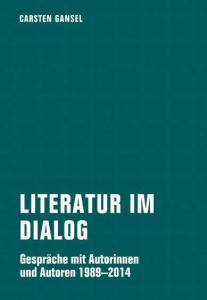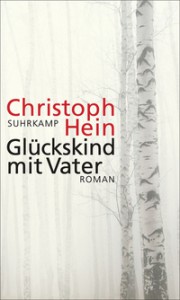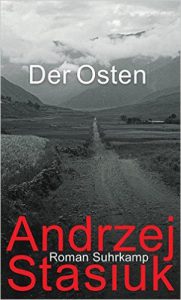
»Der Osten«, das neueste Buch von Andrzej Stasiuk, beginnt damit, dass die Einrichtung eines alten »LPG«-Ladens Stück für Stück zum Abtransport aufgeladen wird. Dabei entzünden sich beim mithelfenden Ich-Erzähler Erinnerungen aus den 1970er Jahren, als er als Kind vor einem solchen Laden mit anderen Menschen auf Lebensmittel in einer Schlange wartete. Als das Fahrzeug mit der Ware eintraf, vernahm er den Benzingeruch, den er sofort mit »Freiheit, Geheimnis und Verlangen«. Beim Wegräumen dieser alten Möbel überkommt ihm nun fast so etwas wie eine Epiphanie über die Dinge, in denen Geschichte und Geschichten abgespeichert sind: »Das Leben war in sie [die Dinge] eingedrungen und erstarrt«. Im Gegenstand befindet sich sozusagen Geschichte aus mehr als hundert Jahren inkubiert: »Die Zeit der Lemken, der Kommunismus und jetzt wir, schwitzend unter der Last«.
Man denkt an Hofmannsthals Roman »Briefe des Zurückgekehrten«. Der Briefroman spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Kaufmann kommt nach fast zwanzig Jahren nach Deutschland zurück. Er erkennt das inzwischen modernisierte und industrialisierte Land nicht mehr wieder. Ein mehr als nur diffuses Unbehagen ergreift ihn. Die Menschen hatten sich verändert, sie waren zusehends geprägt »von dem Geld, das sie hatten, oder von dem Geld, das andre hatten.« Sogar die Dinge erschienen ihm verwandelt, durch industrielle Fertigung konturlos und profanisiert (was man später »Fordismus« nennen wird). Bevor mit Husserl und Heidegger die philosophische Phänomenologie entstand und Richard Sennett Betrachtungen zur fortschreitenden Degeneration des Handwerks (oder, besser, des Werkens mit der Hand) vornahm, deutete Hofmannsthal in diesem Roman an, dass Gegenstände ihre Entstehung und damit auch eine Epoche spiegeln können. Und so ergeht es auch Andrzej Stasiuk, der von solchen Dingen fasziniert ist und sich auf die Reise macht und Menschen trifft, die deren Geschichten erzählen können.