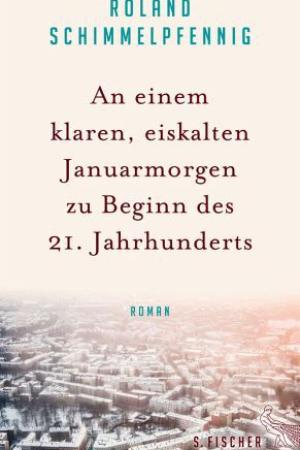
An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Ein Wolf überschreitet einen gefrorenen Fluss. Drei Wochen später: Tomasz fährt nach Berlin zu seiner Freundin Agnieszka. Beide kommen aus Polen; er arbeitet auf dem Bau, sie hat mehrere Jobs, als Putzfrau und Kindermädchen, sechs Tage in der Woche. Es schneit und es ist kalt und Tomasz steht in einem Stau, der mehrere Stunden dauern soll. Er steigt aus und da sieht er den Wolf, macht ein Foto und das wird bald ganz Berlin elektrisieren. Fast gleichzeitig verschwindet ein Mädchen, das von seiner Mutter zuweilen geschlagen wird. Sie ist abgehauen mit dem Nachbarsjungen. Der Busfahrer bemerkt das Fehlen. Währenddessen gehen Mädchen und Junge durch den Wald, finden einen toten Jäger mit Gewehr. Der Vater des Jungen ist Alkoholiker, hat kürzlich einen Suizid versucht und ist in der Psychiatrie. Die Eltern des Mädchens sind geschieden; beide waren oder sind Künstler (gewesen). In weiteren Rollen: Charly und Jacky, ein Ehepaar, das in Prenzlauer Berg einen Kiosk betreibt und Dialoge führt wie in einer RTLII-Soap, ein Ex-Lehrer, eine Praktikantin, die über den Wolf für eine Zeitung etwas schreiben soll, ein Chilene, der Rumäne ist, eine Frau, die ihre soeben verstorbene Mutter noch einmal hassen darf und daher deren Tagebücher verbrennt und ein altes Ehepaar.
Es geht um all diese Figuren (und noch ein paar mehr) in Roland Schimmelpfennigs »An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts«. Sie werden in insgesamt 103, meist kurzen szenischen Einspielern, ein paar Tage im Februar 2003 in und um Berlin aus wechselnder Perspektive begleitet. Kern des Buches ist die Ausreißergeschichte zweier Jugendlicher – des »Mädchens« und des »Jungen«. So wie diese beiden bleiben viele andere Figuren in diesem Buch namenlos und wenn die Namen dann doch – mehr oder weniger zufällig – fallen, werden sie nicht verwendet. Da muss der Leser zwischen dem »Vater des Jungen«, »Vater des Mädchens«, »Mutter des Jungen« und »Mutter des Mädchens« unterscheiden. Später kommen unter anderen noch ein Bruder des Vaters des Jungen und eine Freundin der Mutter des Mädchens hinzu. Das klingt verwirrender als es ist. Im Laufe des Buches entsteht dann eine Reigen-Struktur. Es kommt zu kurzen oder, seltener, längeren Begegnungen der Figuren miteinander. Fast jeder bekommt es einmal mit jedem zu tun (sogar das Gewehr macht die Runde) und man könnte sicherlich schöne Graphiken erstellen, wer wem wann begegnet – wenn es nicht so egal wäre.
Schimmelpfennig erzählt (erzählt?) mit Vorliebe in Parataxen; eine Mischung aus Nachrichtenton und Märchen. Womöglich soll das alles cool oder lakonisch sein, aber diese Sprache hat so viel mit Lakonie zu tun wie ein Abführmittel mit einer Diät. Das wirkt zuweilen unfreiwillig komisch, etwa wenn es heißt: »Alles war falsch, seit Jahren, das begriff er plötzlich, aber es gab auch Dinge, die richtig waren«. Man kann solches Großmuttergebrabbel eines allwissenden Erzählers ein‑, zweimal ertragen, aber dabei bleibt es leider nicht.
Aber gemach: Das Buch liest sich auf den ersten 80 oder 100 Seiten ganz leicht, amüsant und fast unterhaltsam. Irgendwann jedoch geht Schimmelpfennig der Atem aus, er hechelt am Ende der Episoden Bilder herbei, die er zu Cliffhangern macht, damit man neugierig bleibt, wie es mit der jeweiligen Figur weitergeht. Aber diese Cliffhanger sind zu häufig abgegriffene Bilder, die man eher in Heftchenromanen vermuten würde. Wenn etwa der Vater des Jungen, der seit ein paar Tagen »trocken« ist und dies auch bleiben möchte, doch noch das Schnapsglas bei seinem Bruder austrinkt. Genauso weiß man praktisch von Beginn an, dass noch irgendjemand mit dem Gewehr an- oder erschossen werden wird. Als Agnieszka erfährt, dass sie von ihrem Seitensprung Andi schwanger ist, sind die Reaktionen ebenfalls vorhersehbar. Und so ließe der Reigen des Erwartbaren immer weiter spinnen. Dabei ist es nicht schlimm, dass es in den Handlungen kaum Überraschungen gibt. Ärgerlich ist nur, dass auch das Unerwartete, wenn es denn einmal eintritt, nur als reines Gegenbild des üblichen Klischees auftritt.
Die episodenhafte Erzählform verschleiert eine gewisse Zeit die Banalität des Textes. Die Milieus werden, falls sie überhaupt einmal in den Hauptsätzen hervorschimmern, wie Kulissen hin- und hergeschoben. Natürlich sind Künstler lebensuntüchtig und monomanisch. Auf dem Dorf achtet man noch aufeinander. Der Psychiater ist lange schon desillusioniert. Beim Thema Gentrifizierung wird es lustig: Der Zahnarzt, der das Haus kauft, saniert und teurer neuvermietet heißt bei den einen »Blödmann«, bei den anderen »Dr. Nolte.«
Und die Hauptfiguren, »der Junge« und »das Mädchen«? Über deren Beweggründe und Träume erfährt man nichts. Beide agieren nur wie von einer unbekannten Kraft Getriebene. Dafür ist die Topographie von Berlin im Roman recht präsent, was übereifrige Exegeten an Döblin denken lässt, obwohl Döblin mit dieser Form von Prosa rein gar nichts zu tun hat.
Früh wird klar, dass der Wolf das Archaische symbolisieren soll, welches in die »Zivilisation« der Urbanität eindringt. Mit ihm dann taumeln dann auch die Ausreißer, deren Eltern und der stark mit seiner Heimat verbundene, in Berlin schnell an Panikattacken leidende Tomasz – allesamt keine Großstadtbewohner – in diese andere »Wildnis«. Ausnahmslos alle Figuren sind am Leben Leidende, Beschädigte oder Verletzte. Sie zeigen keinerlei Entwicklungen; ihre Aktionen und Ausbrüche sind, wenn sie denn stattfinden, zum Scheitern verurteilt. Zunächst ist es durchaus ein Vorteil, dass der Autor nicht versucht, die Figuren psychologisch auszuleuchten. Aber indem immer nur Handlungen beschrieben werden, bleibt der Leser jeglicher Möglichkeit beraubt, ein Verhältnis zu den Protagonisten zu entwickeln. Sie bleiben einem gleichgültig, werden am Ende sogar lästig.
Das erinnert an eine dystopisch-moderne Adaption von »Hänsel und Gretel« mit einer Prise »Rotkäppchen«. Dass dieses Buch ernsthaft in der Leipziger Buchpreisliste auftauchte, mag man höchstens als Scherz auffassen. Womöglich ließ man sich von dem Superlativ »Deutschland meistgespielter Dramatiker« in Bezug auf Roland Schimmelpfennig hinreißen; ein Etikett, das man schon 2009 über ihn findet. Manchmal soll sowas ja reichen.
Vielleicht eignet sich der Roman noch als veritable Vorlage für einen Film. Benötigt wird nur ein Regisseur, eine Regisseurin, die mit den entsprechenden Schauspielern den blutleeren Protagonisten des Buches Leben einhauchen. Dann kann man wenigstens noch eine Schmonzette daraus machen. Und der Wolf wird sich auch noch finden.
