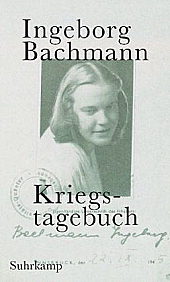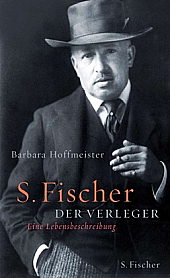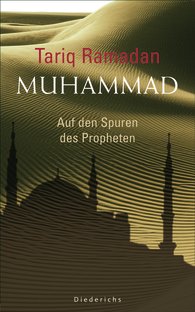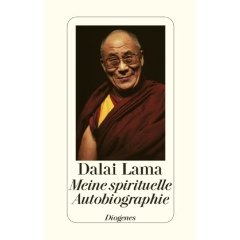Erspart praktisch alles andere zum 1.Weltkrieg: Herfried Münkler http://t.co/B9PomlFXLI
— frankschirrmacher (@fr_schirrmacher) 28. Januar 2014
»Erspart praktisch alles andere zum 1.Weltkrieg: Herfried Münkler« twitterte Frank Schirrmacher am 28. Januar 2014 und verlinkte auf ein Interview mit dem Autor in der FAZ. Ich kann das nicht beurteilen. Neben einigen oberflächlichen, zuweilen effekthascherischen Gedenksendungen in Radio und Fernsehen habe ich neben Herfried Münklers Buch »Der Grosse Krieg – Die Welt 1914–1918« nur noch Ernst Pipers »Nacht über Europa« gelesen.
Die Bücher sind kaum miteinander vergleichbar. Münkler liefert eine Gesamtübersicht des Krieges auf rund 780 Seiten mit 70 Seiten kleingedruckter Anmerkungen. Die Bibliographie am Ende des Buches – satte 40, ebenfalls kleingedruckte Seiten mit über 800 Literaturverweisen – bietet für nahezu jedes Thema zum Ersten Weltkrieg – und sei es noch so speziell – Vertiefungsmöglichkeiten. Piper bietet mit Prolog und Exkursen 15 Aufsätze auf 485 Seiten mit mehr als 50 Seiten Anmerkungsteil. Dabei stellt er einzelne Aspekte des Krieges in den Vordergrund wie die Kriegslust der Intellektuellen, die Rolle der Schweiz und das Wüten der Deutschen in Belgien. Detaillierte militärische und geostrategische Erläuterungen fehlen dagegen.