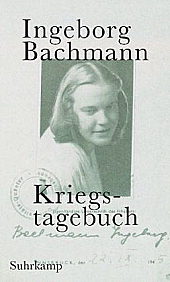Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans Höller
Ingeborg Bachmann hatte mit Schreibmaschine auf »sechs engzeilig beschriebenen DIN-A-4-Blätter[n]« ihre Erlebnisse von März bis Juni 1945 aufgeschrieben, wobei allerdings der erste Eintrag aus dem September 1944 stammen könnte, als Ingeborg Bachmann in die »Lehrerbildungsanstalt« eintrat und in den letzten Monaten des Krieges Hilfs-Lehrerin wurde. Vermutlich schrieb sie diese Seiten aus ihrem (nicht erhaltenen) Tagebuch ab. Sie werden nun mit dem leicht reißerischen Titel »Kriegstagebuch« »erstmals« (Klappentext) veröffentlicht. Es beginnt im Buch auf Seite 9 und endet auf Seite 24. Ab Seite 16 ist der Krieg zu Ende; man erfährt von der britischen Besatzung und deren Administration, von Verhören, Bachmanns eher apathischen Eltern und dem euphorischen Gefühl für den Frieden, welche die fast Neuzehnjährige empfand – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Erwachsenen im Ort, deren Welt zusammenbrach.Nach dem Krieg lernt Bachmann Jack Hamesh kennen. Hamesh ist Jude, Jahrgang 1920, also sechs Jahre älter als Bachmann, in Wien geboren und lebte bis 1938 dort. Danach emigrierte er nach Großbritannien. Es ist nicht klar, ob sein Name dort »anglisiert« wurde. 1945 kam er als britischer Soldat in seine Heimat zurück. Hamesh befragt Bachmann unter anderem nach ihrer BDM-Zugehörigkeit. Obwohl sie die Wahrheit spricht, wird sie nervös und verlegen, was für allerlei Überlegungen Anlass gibt. Ein paar Tage später spricht er sie auf der Straße an. Anfangs ist sie reserviert, aber als sie miteinander über Literatur ins Gespräch kommen, wird sie enthusiastisch.
»Nein, mit den Erwachsenen kann man nicht mehr reden« konstatierte sie unmittelbar vor dem »Zusammenbruch«. Hier ist nun endlich jemand, mit dem sie reden kann. Ein intellektuell ebenbürtiger Gesprächspartner, der Literatur schätzt und Stefan Zweig, Thomas Mann und Hofmannsthal kennt. »Ich habe noch nie im Leben soviel geredet« gibt sie zu. Auch über »Sozialismus und Kommunismus« gibt es einen regen Austausch. Einziger Wermutstropfen: »Gedichte hat er nicht besonders gern.«
Als er ihr die Hand küsst, reagiert sie wie ein Backfisch, der sich die geküsste Stelle nicht mehr waschen will und klettert auf einen Baum. Ihr imponieren seine guten Umgangsformen, seine freundliche Zurückhaltung. Hamesh ist überrascht und angetan von Bachmanns Kenntnissen der einst verbotenen Literatur. Schnell wird das »Verhältnis« zum Dorfgespräch. Sie bemerkt bitter, wie argwöhnisch man dieses Gehen »mit dem Juden« (auch vonseiten ihrer Mutter) sieht und nimmt diesen antijüdischen Affekt als Kontinuum aus der NS-Zeit durchaus wahr.
Die elf erhaltenen Briefe von Jack Hamesh an Ingeborg Bachmann, geschrieben zwischen April 1946 und Juli 1947 (es sind eigentlich nur neun; die anderen beiden Schriftstücke sind sehr kurze Telegramme), werden von Seite 27 bis 69 abgedruckt. Sie erweisen sich – wenn man nicht gerade ein Ingeborg-Bachmann-Exeget ist – in mancher Hinsicht als die aufschlussreichere Lektüre. Briefe der Bachmann an Hamesh (auf die er teilweise Bezug nimmt) sind offensichtlich nicht erhalten. Dennoch lassen sich aus den Briefen Hameshs teilweise Rückschlüsse auf Bachmanns Reaktionen ableiten.
Hamesh verlässt Österreich im Laufe des Frühjahrs 1946 über Neapel nach Palästina. Die genauen Gründe für diese (erneute) Emigration bleiben unklar. Der Abschied von Österreich und besonders von Ingeborg Bachmann fällt ihm schwer. Er vermeidet, ihr seine Liebe direkt zu gestehen (zweimal kommt er dem sehr nahe). Mit wachsender Entfernung wird die Heimatlosigkeit schier unerträglich. Wie die Bachmann in ihrem Tagebuch aus dem Sommer 1945 beschwört auch er den Frühling, den Sommer, jene herrlichen Tage des Zusammenseins (und bezieht – wie es sich gehört – die Verwandten Bachmanns sicherheitshalber mit ein).
Ingeborg Bachmann studiert inzwischen in Wien. In einem Brief spricht er an, dass sie nicht von einem Wiedersehen schreibt; Hamesh ist voller Selbstzweifel. Er überlegt, ob der ihm entgegengebrachte Respekt nur aufgrund seines Status als britischer Besatzungssoldat resultierte. Seine Einsamkeit, die er mit den Erinnerungen eher noch verstärkt, muss enorm gewesen sein. Seine »Sehnsucht nach Ober-Vellach« und damit implizit nach Ingeborg Bachmann verströmt bisweilen eine herzzerreißende Melancholie. Er möchte »lachend dieser Zeit trotzen«, aber das kommt einem wie ein Pfeifen im Wald vor. Ihr dürfte früh nicht entgangen sein, dass hier jemand bis über beide Ohren verliebt ist. Man ahnt aus Hameshs Erwiderungen, dass sie in ihm wohl nur einen guten Freund gesehen hat. Und noch aus der seligen Zeit vom Sommer 1945 ist bei Hamesh der »schweigsame Schwimmnachmittag« in Erinnerung.
Die letzten von Hamesh mit Schreibmaschine verfassten Briefe sind lang. Hochinteressant und aufschlussreich ist der Einblick, den man vom Palästina 1946/47 bekommt. Er schlägt sich mit mehreren Berufen durch, sagt von sich selber, er sei »zufrieden, aber nicht glücklich«; sicherlich eine euphemistische Formulierung. Ein glühender Zionist ist er genau so wenig wie religiös. Dennoch glaubt er, dass die Immigration von Juden nach Palästina eine Zwangsläufigkeit ist und vielleicht die einzige Möglichkeit, dem »Urübel aller Übel«, dem Antisemitismus, zu entgehen. Er ist der Überzeugung, »die Araber« würden von den Einwanderern profitieren, sowohl ökonomisch als auch sozial. Und einmal lüftet er auch den elaborierten Freundlichkeitscode, was die Österreicher im Verhältnis zum Nationalsozialismus angeht und spricht darüber »wo die Schuld ist«.
Über Jack Hamesh gibt es offensichtlich keine weiteren Informationen mehr. Seine Spur verliert sich 1947. Man kann ihn zweifellos als Intellektuellen bezeichnen. Umso unverständlicher, dass man die orthografischen Fehler (»villeicht«, »nähmlich«, »Maschiene«) und die oft unbeholfen wirkende Grammatik, die nicht zuletzt seiner Emigration von 1938–45 nach England geschuldet waren, unkorrigiert ließ. Höller suggeriert, dies sei aus Gründen der Authentizität geschehen und durchaus Praxis in der Textwiedergabe von Schriftstellern. Vorher erklärt er, dass in Ingeborg Bachmanns Aufzeichnungen Schreibfehler korrigiert wurden. Dieses unterschiedliche Vorgehen ist inkonsequent und prägt unbewusst das Urteil des Lesers über die beiden Schreiber: Hamesh erscheint dabei in deutlich schlechterem Licht, auch wenn es durchaus anders gedacht sein sollte.
Sogar die Beschriftungen der Kuverts von Hameshs Briefen werden in diesem Buch dokumentiert. Aber ein Fehler wurde bei aller Akribie übersehen: Die Briefe werden chronologisch aufgelistet. Der erste Brief ist von »Ostern 1946« (er wurde abgegeben, nicht verschickt). Bei Brief Nummer 3 findet sich das Datum »27. Juli 1946«. Dies muss jedoch falsch sein, da die nachfolgenden Dokumente auf den 3. bzw. 6. Juli verweisen (hier begeht Hamesh einen Fehler, in dem er »6. Juni« schreibt, was Höller korrigiert). Wo war hier das Lektorat?
Wie erwartet erläutert Hans Höller im Nachwort die Bedeutung dieses »Kriegstagebuchs« auf das spätere Werk Ingeborg Bachmanns. Es wird deutlich, wie Teile des Erlebten im »Galicien-Kapitel« des »Buch Franza« verarbeitet werden. Nicht schlecht staunt man jedoch, wie Höller diese wenigen Seiten zum »Grundtext für das Verständnis der ungeheueren Zeilen über das Drama von Vater und Tochter« der »Traum-Szenen von ‘Malina’ « erhebt. Und wo er die »Auseinandersetzung mit dem ‘Vater’ « ausmacht, hat sich dem Leser auch nach mehrmaliger Lektüre nicht erschlossen. Spätestens hier wird diesen Eintragungen eine Bedeutung zugeschrieben, die reichlich übertrieben erscheint. Allerdings ist der Versuch, durch Sensationalisierung Aufmerksamkeit zu erringen, nicht unbedingt neu.