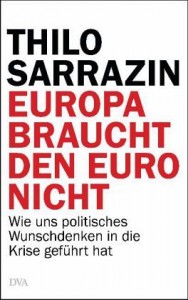1
»Ein andres Ideal läuft vor uns her, ein wunderliches, versucherisches, gefahrenreiches Ideal, zu dem wir Niemanden überreden möchten, weil wir Niemandem so leicht das Recht darauf zugestehn: das Ideal eines Geistes, der naiv, das heisst ungewollt und aus überströmender Fülle und Mächtigkeit mit Allem spielt, was bisher heilig, gut, unberührbar, göttlich hiess...« (FW 636f.) So schreibt Nietzsche gegen Ende seiner Fröhlichen Wissenschaft, und man darf sich fragen, wem er dieses Recht zugestanden hätte außer sich selbst oder, besser gesagt, seinen Idealfiguren, diesen höheren Menschen, die er mal zu Über‑, mal zu Unmenschen stilisiert.
Aber was hat es eigentlich mit der Naivität auf sich, der ersten Eigenschaft des angekündigten Wesens? In seinem Spätwerk verzettelt sich Nietzsche regelrecht im Willen zu allem möglichen und faßt die diversen Strebungen unter dem Schlagwort eines Willens zur Macht zusammen, der eine Steigerung aller Lebenskräfte zum Ziel habe. Mit dem Wort »Lebenskräfte« – oder einfach: »das Leben«, ein denkbar vager Terminus – benennt Nietzsche häufig Instinkte, also Regungen, die körperlich, nicht geistig und wohl auch nicht durch den Willen bestimmt sind. Je länger der Philosoph die Instinkte fixierte, desto höher drehte sich die Spirale der Reflexion und des Willens, während der Abstand von dem, was der Körper möglicherweise brauchte, immer größer wurde. Schon Kleist hatte die Wiedererlangung von Naivität durch ein immerzu gesteigertes Bewußtsein angedacht: das berühmte Marionettentheatertheorem. Wie man eine unendliche Wegstrecke zurücklegt, hat freilich auch Nietzsche nicht zu zeigen vermocht. Im Gegenteil, seine neuen Schöpfungen blieben aus, sie wurden immer nur angekündigt und umschrieben. Die Unabgeschlossenheit und Unabschließbarkeit hat sich in die Form und Dynamik seines Werks eingeschrieben. Liest man den Marionettentheateraufsatz genau, Wort für Wort, kommt man zu dem Schluß, daß Kleist an die Erfüllbarkeit des von ihm formulierten Programms nicht glaubte. Es muß – im strengen Wortsinn – ein Ideal bleiben, ein unerreichbarer Stern, der vor uns, den Denkenden, herzieht und uns möglicherweise leiten kann, zu einem unbekannten Ort. Der Denkende in seiner Wirklichkeit ist kein »Gliedermann«, kein geistloses Wesen, doch er ist auch kein Gott. Menschliches Sinnen und Trachten wird sich wohl oder übel zwischen diesen beiden Figuren abspielen müssen. Oder kann man durch einen Willensentschluß zum Gott werden?