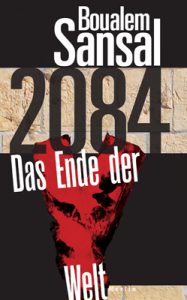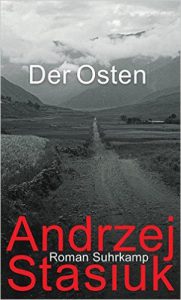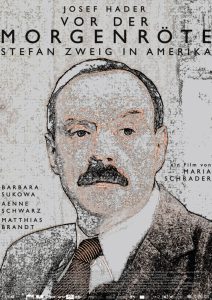Wenn Gesellschaften – aus welchen Gründen auch immer – trotz eines exorbitanten Wohlstands mit einem diffusen Unbehagen der Zukunft entgegen sehen, weil sie vor Umbrüchen mit unsicherem Ausgang stehen, dann ist Zeit für dystopische Romane, die dann die eher harmlos daherkommende (leider zu oft banale) Fantasy oder bewusst technikaffine Science-Fiction-Seligkeit überwuchern. Nicht zuletzt in der aktuellen deutschsprachigen Literatur gibt es einen Trend zur Dystopie, vielleicht auch einfach nur, weil es im Alltag so gar keine Abenteuer mehr zu erleben gibt.
Bei Boualem Sansal sieht dies anders aus. Der 1950 in Algerien geborene Autor fand erst spät zum literarischen Schreiben, avancierte aber schnell zum bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller seines Landes und bekam 2011 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Jetzt hat er mit »2084 – Das Ende der Welt« einen Weltuntergangsroman geschrieben. Das Buch war zunächst in Algerien nicht zu erhalten und sorgte für Diskussionen in Frankreich. Seit Mai liegt es auch in einer deutschen Übersetzung von Vincent von Wroblewsky vor.
Das deutsche Feuilleton befragt Sansal ausgiebig, aber noch mehr möchte man über seine Einschätzungen zur aktuellen politische Lage wissen, den Bedrohungen durch das, was man gemeinhin »Islamismus« nennt. Sansal hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Er bezichtigt besonders die westliche Linke als naiv im Umgang mit dem politischen Islam, was diese zum Anlass nimmt, ihn in eine neurechte Ecke zu stellen; das inzwischen bekannte Gesellschaftsspiel. Die Erfahrungen, die Sansal in Algerien macht und gemacht hat, werden hierbei gerne heruntergespielt. Die Politisierung eines solchen Romans hat allerdings meist zur Folge, dass die Diskussion weniger um das Buch als um die politischen Thesen des Autors kreist. Dies erzeugt Erwartungshaltungen, die je nach Orientierung enttäuscht oder bestätigt werden. Dabei tritt dann die literarische Qualität eines solchen Buches allzu oft in den Hintergrund. Weiterlesen