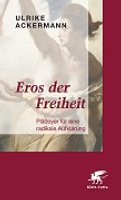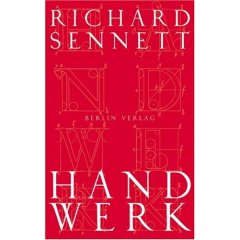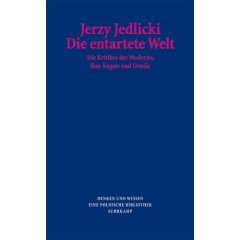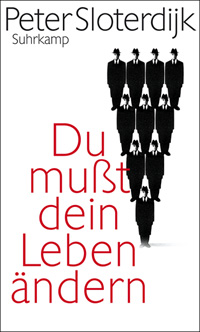
Du mußt dein Leben ändern
So wie der Torso Apollos im Louvre von Paris im Jahr 1908 zum Dichter Rainer Maria Rilke mit seiner durchlichtende[n] Äußerung des Seins in einem anthropomorphen Akt zu sprechen beginnt und ihn aufruft »Du mußt dein Leben ändern«, so möchte auch Peter Sloterdijk den Leser mitreissen und affizieren. Begeistert ob dieser (säkularistischen) Inspiration weist er in seiner höchst originellen Lesart des Rilke-Gedichts en passant auf die beiden wichtigsten Worte dieses absoluten Imperativs hin: Zum einen das »Müssen« – zum anderen das Possessivpronomen: hier sind weder Ausflüchte noch Delegationen erlaubt und die Konsequenzen könnten einschneidend sein.
Und so nimmt Sloterdijk Fahrt auf zur Lebensänderungs-Expedition. Dabei soll (in Paraphrase zu Wittgenstein) der Teil der ethischen Diskussion, der kein Geschwätz ist, in anthropotechnischen Ausdrücken reformuliert werden. So wird der Übende, der Akrobat, zur Galionsfigur des Sich-Ändern-Wollenden installiert und bekommt dabei fast zwangsläufig das Attribut »asketisch«, denn der größte Teil allen Übungsverhaltens vollzieht sich in der Form von nicht-deklarierten Askesen. Kein Ziel kann da hoch genug sein (und das im wörtlichen Sinn). Rilkes Vollkommenheits-Epiphanie als unumkehrbares Aufbruchsmoment, als Vorbild für den heutigen Trägheitsmenschen. Sloterdijk als Trainer (das ist derjenige, der will, daß ich will oder doch eher eine Re-Inkarnation Zarathustras, denn kein Zweifel kommt auf, daß hier Nietzsche der grosse Motivator ist, sozusagen der »Über-Trainer«.