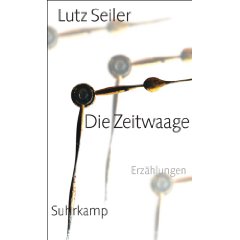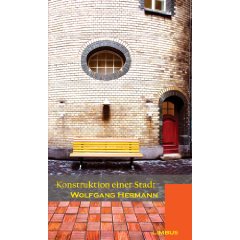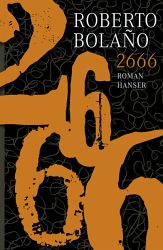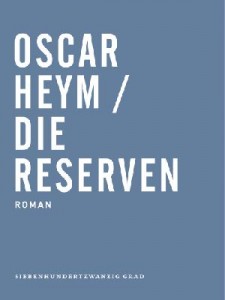
Deutschland 1976, mitten im »Kalten Krieg«. Die Ölkrise ist zwar vorüber (die Sonntagsfahrverbote wurden im Dezember 1973 aufgehoben), aber der Schock sitzt tief. Wenzel Hoffmann, deutsch-amerikanischer Geologe kommt nach Deutschland, um in halb-geheimer Mission nach Öl zu bohren. Er wacht aus dem Flug aus bleierner Müdigkeit auf und stellt fest, dass seine Unterlagen verschwunden sind. Er rennt zurück zum Flieger, trifft dort aber nur einen alten Mann, der ihn kurz an seinen Vater erinnert, und die attraktive Stewardess Margarethe (Mag). Beide können ihm nicht helfen; die Unterlagen bleiben unauffindbar. Mag und Wenzel verbringen entgegen jeder Planung mehrere Tage zusammen und geben sich hemmungslosem Sex hin.
Wie ein kleiner Taugenichts wird dieser Wenzel eingeführt, der mit mehreren Tagen Verspätung in dem fiktiven (?) Ort Gronau im deutsch-deutschen Grenzgebiet eintrifft (das reale Gronau-Leine stimmt geografisch nicht ganz mit dem Erzählort überein; allerdings gibt es tatsächlich Erdölvorkommen in Niedersachsen die gefördert werden).

 In
In 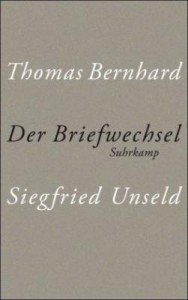 Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.
Am 22. Oktober 1961 wendet sich Thomas Bernhard in einem höflich-distanzierten Brief an Siegfried Unseld, der wie folgt beginnt: Sehr geehrter Herr Dr. Unseld, vor ein paar Tagen habe ich an Ihren Verlag ein Prosamanuskript geschickt. Damit wollte ich mit dem Suhrkamp-Verlag in Verbindung treten. Auf den im Faksimile im Buch abgedruckten, mit Schreibmaschine getippten Brief kann man erkennen, dass Bernhard ein Schreibfehler unterlaufen war. Es steht dort nicht »Suhrkamp«, sondern »Suhrkampf«. Das »f« wurde handschriftlich durchgestrichen.