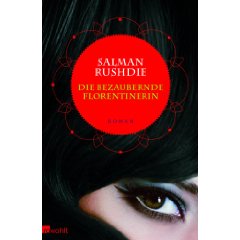
In einem Ochsenkarren kommt er daher, der gelbhaarige Fremde, ein anmutiger Narr…vielleicht aber auch gar kein Narr. Nicht sitzend sondern stehend, aufrecht wie ein Gott, im rumpelnden Gefährt geschickt die Balance haltend. Man schreibt das Jahr 1572 (laut Klappentext) und befindet sich in Fatehpur Sikri, einem Ort jenseits von Religion, Region, Rang und Stamm, der Stadt der schönen Lüge, der Hauptstadt des Reiches von Jalaluddin Muhammad Akbar, dem indischen Grossmogul, dem Weltverschlinger.
Der Fremde sei im Namen der englischen Königin unterwegs und müsse Akbar unbedingt persönlich eine Botschaft der Monarchin übermitteln. Dafür hat er die weite Reise von Europa über das Kap der Guten Hoffnung nach Indien gemacht. Zunächst geht er allerdings in ein Hurenhaus, macht Bekanntschaft mit den Huren Skelett und Matratze. Dort erprobt er erst einmal eine Salbe, die sexuelles Verlangen steigern soll, bevor die beiden Huren ihn mit speziellen Düften parfümieren. Er soll riechen wie ein König damit er die verschiedenen Instanzen am Hof entsprechend überwinden kann und auch tatsächlich zu Akbar, dem Schirmherr der Welt, vorgelassen wird.
Diesen Akbar hat es wirklich gegeben. Allerdings heisst es bei Rushdie ausdrücklich, dass es sich bei diesem Buch um ein »Werk der Phantasie« handele und »im Interesse der Wahrheit…einige Freiheiten im Umgang mit dem historisch Verbürgten« notwendig waren. Diese Freiheiten werden bereits bei der Lektüre des Wikipedia-Artikels über den historischen Akbar deutlich. Wobei die Frage bleibt, warum es dann überhaupt der historischen Personen und Orte bedarf, wenn sie derart verbogen werden (freilich ein in den letzten Jahren immer häufiger verwandtes Verfahren).
Grausam und melancholisch
Rushdies Akbar ist ein (aus heutiger Sicht natürlich) grausamer Despot, was aber oft genug dem Selbstverständnis des absoluten Herrschers eines grossen Reiches geschuldet zu sein scheint. Seine andere Seite ist die Melancholie; dann ist er schlachtenmüde…, nachdenklich, …poetisch und sogar zu Übergewicht neigend. Ein eher vereinsamter Regent, der mit sich selber darüber philosophiert, ob er nicht lieber »Ich« zu sich sagen oder doch beim »Wir« bleiben soll (er bleibt beim »Wir«) und sich nach den Freuden des Diskurs[es] sehnt. Als er einen aufmüpfigen Rebellen köpfte, überkam ihn wieder dieser Dämon der Einsamkeit und er ängstigte sich, dass er vielleicht just den Menschen geköpft haben könnte, mit dem er in einen schönen Diskurs hätte treten können.
Akbar gibt sich freidenkerisch (er lässt ein Zelt errichten, in dem Philosophen und Gelehrte diskutieren können), bleibt jedoch empfindlich, wenn er glaubt, dass seine Autorität untergraben zu werden droht und umgibt sich – ganz unintellektuell – mit Schmeichlern, deren Kopf auch immer ein bisschen lose zu sitzen scheint, die er aber bei entsprechenden »Vergehen« grosszügig begnadigt (du darfst weiterleben).
Überfluss ist selten vorteilhaft (beruhigend, dass dies keine primäre Erfahrung der Moderne zu sein scheint), so auch bei Haremsdamen. Der sexbesessene Rushdie-Akbar ist den realen Damen wohl überdrüssig und imaginiert sich stattdessen seine liebste Konkubine – eine gewisse Jodha. Die Vorzüge dieser Phantasiegestalt liegen auf der Hand: Keine echte Frau konnte sein wie sie, vollkommen in ihrer Aufmerksamkeit, absolut anspruchslos, immerzu verfügbar. Sie war …das perfekte Fabelwesen… Der Rushdie-Akbar weiss offensichtlich, dass das wichtigste Geschlechtsorgan das Gehirn ist. Und weil ihm niemand zu widersprechen wagt, wird die imaginäre Lieblings-Geliebte von den anderen Frauen gefürchtet. Ihr Einfluss wuchs stetig, Künstler besangen sie in ihren Liedern, und in Atelier und Skriptorium wurde ihre Schönheit mit Versen und Bildnissen gefeiert.
In diese Welt versucht nun der Fremde (bereits auf Seite 15 erfährt der Leser, dass dieser mit einem Geheimnis angereist ist), der sich zunächst Uccello di Firenze nennt, Einlass zu finden. Durch die Parfümierungen der beiden Huren und durch Glück und Geschick überwindet er die diversen Türhüter und kommt tatsächlich ins Machtzentrum um Akbar, seiner Familie, seinen beiden Beratern Birdal und Abul Fazl (der Mann, der alles wusste – nur nicht, dass er Jahre später in einen Hinterhalt geraten wird) und Akbars treuesten Spion, dem haarlosen Eunuchen Umar der Ayyar.
»Liebe auf den ersten Blick«
Mit grosser, theatralischer Geste verliest Uccello eine Botschaft der Königin von England (Jahre später, als man des Schriftstückes habhaft wird, stellt sich heraus, dass die eigentlich harmlose Bitte, den Handel Englands mit Indien zu ermöglichen, von Uccello enorm aufgebauscht und für seine Zwecke manipuliert wurde). Aus Uccello wird der Mogor dell’Amore, was die Skepsis unter den Beratern Akbars und im Umfeld des Hofstaates vergrössert. Aber fabulieren kann der Fremde. Alleine die Geschichten der abenteuerlichen Überfahrt sind kunstvoll gesponnenes Seemannsgarn. Akbar bringt diesem schwadronierenden Grossmaul sofort Liebe auf den ersten Blick entgegen, ist entzückt und belustigt, bleibt aber – ganz Herrscher – äusserlich reserviert.
Es kommt, was kommen muss: Im Hofstaat wird Mogor immer kritischer beäugt; Kabale bilden sich. Akbar stellt ihn zur Rede, es kommt zu einem »Prozess« und aus Uccello beziehungsweise Mogor dell’Amore wird nach entsprechender Verhandlung und Geständnis Niccolò Vespucci, der nun die Ungeheuerlichkeit besitzt zu behaupten, er sei ein Onkel Akbars; Sohn der schönsten Frau, die die Welt je gesehen hat, einer Tochter von Dschingis Khan, Qara Köz, auch Angelica genannt, der schwarzäugigen Prinzessin.
Und Niccolò beginnt nun die Geschichte und Geschichtchen der drei Freunde aus Florenz zu erzählen. Von Antonio Argalia, genannt der Türke, der später der Geliebte eben jener Angelica werden sollte (aber – und das verwirrt alle – alleine schon aus mathematischen Gründen nicht der Vater von Niccolò Vespucci sein kann), Niccolò ‘Il Machia’, womit kein geringerer als Niccolò Machiavelli gemeint ist (dessen Vita nur episodisch ausgeführt wird) und Ago Vespucci, ein Neffe des grossen Amerigo.
Bilderreich, detailversessen, redundant – und ermüdend
Auf den nächsten rund zweihundert Seiten entwickelt Rushdie ein opulent-barockes, exotisches Erzählpanorama: bilderreich, detailversessen, redundant, namen- und zahlenmystisch (häufig dauert etwas ein Jahr und einen Tag oder 101 Tage und es gibt eine Nacht der hundertundeinen Kopulation), verspielt, ausschweifend bis zotig – und für den Leser derart ermüdend, dass man die gelegentlichen ungeduldigen Einwürfe Akbars (dem diese Geschichten erzählt werden) nur allzu gut nachvollziehen kann.
Es gibt zwei Erzählperspektiven – zum einen die des auktorialen Erzählers, der in und um Akbars Palast spricht, auch Akbars Gedanken kennt und reflektiert und die andere des weit ausholenden, ostentativ erzählenden Niccolò Vespucci. Die Unterschiede sind marginal; Klang und Stil der beiden Erzähler sind zum verwechseln ähnlich, aber auf solche Details kommt es offensichtlich (leider) nicht an. Am Ende des Buches findet sich eine Bibliografie, die zeigt, welcher Literatur Rushdie sich für dieses Buch bedient hat. Neben Sachbüchern über die Zeitgeschichte des 16. Jahrhunderts in Florenz, der Medici und Indien (derer er sich nur bedient zu haben scheint, um sie zu ignorieren oder umzudichten), finden sich dort auch fiktionale Werke, wie zum Beispiel (merkwürdigerweise) Italo Calvino (den Rushdie verehrt) und natürlich auch der »Orlano Furioso«, der »Rasende Roland« und der Kamasutra. Andere Bücher, denen er Motive entlehnt, führt er merkwürdigerweise nicht auf, so beispielsweise die Geschichten aus tausendundeiner Nacht, Boccaccios »Decamerone« (einmal liest jemand dieses Buch) oder Süskinds »Das Parfüm«.
Als der Leser dann taumelnd vor Mattigkeit vor dem letzten Drittel des Buches steht sind Qara Köz mit ihrer Gefährtin Spiegel endlich in Florenz angekommen. Und plötzlich, wenn alle Schlachtfelder verlassen und Kriege geführt sind, wenn alle Seefahrer angekommen und die fast unzähligen Rand- und Nebenfiguren entweder tot, geflüchtet oder tatsächlich (endlich!) unwichtig geworden sind: dann beginnt das Buch auf einmal zu leuchten und zu flirren.
Von der Zauberin zur Hexe
Auf einmal gelingt es Rushdie den Leser wieder aufzuwecken, den Erzähl-Nebel wegzupusten und den Zauber der schönen Frau und ihrer fast so schönen, mit ihr untrennbar verbundenen Gefährtin lesbar, spürbar, erlebbar zu machen. Diese Schilderung der Verzauberung der Bewohner der vierzigtausend Seelen-Stadt Florenz: ein Brückenbau zwischen den grossen Kulturen Europas und des Ostens scheint sich da plötzlich zu ergeben. Sie anzubeten, war der Freude genug heisst es dann, wenn die Schönheit jegliches sexuelle Verlangen sekundär werden lässt und in den Hintergrund schiebt. Dieser Pesthauch der Faszination den Qara Köz verströmte und der sich rasch in der gesamten Gegend…ausbreitete, diese Schönheit und Grazie der unverschleierten Frau(en) lassen die Stadt in friedliche Verzückung fallen. Sogar von Wundern ist die Rede und der Klerus hat keine Einwände.
Diese Zeit, die wohl einige Jahre umfasst, rafft Rushdie, denn hier spielt sich das Erzählenswerte nicht in der Idylle ab. Und so macht sich dann irgendwann eine Erschöpfung bei Qara Köz bemerkbar (vermutlich sind Schönheit und Liebreiz anstrengend und die Dame ist schon 28 Jahre alt), es gibt Denunziationen (Sarazenenhure); die Stimmung kippt. Während Argalia als »condotierre« (eine Art Feldherr einer Söldnerarmee) mit seinen Unbesiegbaren die Stadt Florenz auf einem Schlachtfeld verteidigt, wird die fremde Schönheit von Lorenzo Medici unverhohlen bedroht, aber als dieser nach einem Fest plötzlich stirbt, wird aus der Zauberin, der inoffiziellen Schutzheilige[n] der Stadt plötzlich (plötzlich?) die Hexe und wie dieser kurze Weg von [der] Zauberin zur Hexe erzählt wird, das ist intensiv, dicht und packend. Zwar kommt Argalia mit seinem stark reduzierten Heer gerade noch rechtzeitig um die Prinzessin zu retten, aber er ist verwundet, seine Haut weiß wie der Tod und wenig später stirbt er und Angelica und Spiegel ziehen weiter mit dem neuen Gefährten Ago Vespucci und sie lassen sich von Andrea Doria nach Amerika, in die Neue Welt (»Novus Mundus«) verschiffen (und Akbar ärgert es beim Anhören der Geschichte, dass die Westler diese bizarre[n], unfassbare[n] Männer und Frauen mit Federn, Haut und Knochen »Indianer« nennen).
Und dann sind wir wieder am Palast von Akbar, der am Tag seines vierundvierzigsten Geburtstags (das müsste also – folgt man der Historie – 1586 gewesen sein) überlegt, den skurrilen, geschwätzigen jungen Vagabunden als seinen Sohn anzunehmen. »Seine« Jodha wird in der Imagination Qara Köz immer ähnlicher.
Aber längst ist Akbar nicht mehr der mächtige Herrscher. Kronprinz Salim, einer seiner Söhne, ein brutaler Folterer, hatte die engsten Berater seines Vaters in Hinterhalte geschickt und ermorden lassen und versucht, seinen Vater politisch zu schwächen. Akbar stärkt dennoch demonstrativ Salims Position als Kronprinz (mangels Alternative, denn die anderen Söhne sind der Trunksucht verfallen und noch untauglicher für die Nachfolge). Als Salim heiratet und seine Frau weitere Intrigen gegen den Fremden spinnt, beginnt Niccolòs Stellung immer fragiler zu werden. Er soll nun endlich die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit erzählen, denn eine Entscheidung soll fallen (alle Optionen offen – von »Adoption« bis Exekution). Niccolò bleibt bei seiner Version der Geschichte – Akbar entwickelt eine andere. Der Grossmogul hat die Geduld verloren und verbietet den Umgang mit dem Fremden. Niccolò flüchtet mit den beiden Huren Skelett und Matratze. Akbar, der am Ende noch eine Anweisung zum Entkommenlassen gab, verfällt abermals in Melancholie ob der Abwesenheit des inzwischen doch irgendwie liebgewonnenen Kauzes und wir erfahren dann auf der letzten Seite noch das »Geheimnis« von Niccolò (welches, genauer gesagt, zwei Geheimnisse sind – beide werden aber hier nicht verraten).
Hölzerne Figuren, bunt kostümiert
Insbesondere wenn die Geschichte zum reflektierenden Akbar geht, zeigt sich die Schwäche des Buches. Diese Passagen wirken hölzern und das nicht nur, weil sie im Gegensatz zum sonstigen ostentativen Erzählen stehen. Mit Leben erfüllt Rushdie nur die Titelheldin; das andere »Personal« bleibt seltsam matt und hat die Aura einer Folkloregruppe – sowohl im reflexiven als auch im magischen Erzählen. So nimmt man am Ende mit einer gewissen Gleichgültigkeit dieses Geheimnis von Niccolò Vespucci auf; eine Figur, die beim Leser auf vierhundert Seiten kaum Empathie erzeugen konnte.
»Die bezaubernde Florentinerin« (»Die Zauberin von Florenz« wäre die treffendere Übersetzung gewesen und würde nicht sofort an eine US-amerikanische Fernsehserie der 60er Jahre erinnern) ist irgendwie eine Mischung zwischen Scheherazade, Umberto Eco, Robert Louis Stevenson, einer Prise Lord Byron und – pardon – Karl May. Rushdie gilt natürlich zu Recht als Vertreter des »magische Realismus«, der dezidiert anders erzählt als die (angeblich so individualistische) westliche, moderne Literatur (die – zugegeben – allzu oft eine Art lakonischen »Neorealismus« feiert oder akribisch das Seelenheil der Protagonisten bis in die letzten Verästelungen ausleuchtet). Insofern geht es nicht darum, Rushdie mit einem klassischen europäischen oder amerikanischen Erzähler der Gegenwart zu messen. Auch die Tatsache, dass hier Rekurs auf das 16. Jahrhundert genommen wird, kann nicht per se gegen den Roman zu sprechen.
Aber wenn bei all diesem überbordenden Erzählen, dieser wuchtig daherkommenden Fabulierlust letztlich nur ein L’art pour l’art-Sentiment bleibt, wenn doppelbödiges, hintergründiges, ja diabolisches, ausbleibt oder bestenfalls Fassade eines kulissenschieberisch agierenden Erzählmonsters wird und wenn es dabei fast nur noch um schöne Formulierungskünste zu gehen scheint (und – das ist das ernüchternde und überraschende – so oft keine Sprache gefunden wird, sondern nur die Worte klingen gelassen werden) – kurz: wenn die Harmlosigkeit dominiert und Figuren wie bunt kostümierte Holzpuppen wirken, wenn Niccolò Vespucci, die drei Freunde, die schöne Angelica, der indische Grossmogul und sein Hofstaat (nebst virtuellen und realen Lustdamen) wie Stereotypen einer Pappmaché-Märchenwelt wirken und Rushdie als ein Animateur eines virtuellen Phantasialands daherkommt, dann vermag auch der geduldigste Leser irgendwann jener Mischung zwischen Ödnis, Übersättigung und gähnender Langeweile nicht mehr widerstehen zu können und eine Frage schiebt sich in den Vordergrund: Warum [das alles]?
Und der vielleicht schon mit allerlei »westlicher« Literatur verdorbene Rezipient ist leider nur teilweise mit Qara Köz’ und Spiegels Geschichte versöhnt. Zu selten wird ein Zauber durch das Erzählte erzeugt – zu oft wird bloss bebildert. Nein, das hier ist kein Gedächtnispalast, auch kein Bordell der Erinnerungen. Eher ein kleines Dachstübchen.
Die kursiv gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.

Ich täte gerne einen Roman von Ihnen lesen. Ich denke, wenn man erkennt, wie so eine kleines Dachstüblein (wie Rushdies angeführtes Werk) konstruiert und beschaffen ist, da könnte man aus all den Erkenntnissen heraus, imstande sein, ein Buch zu schreiben, das ein solides Haus auf einem solden Fundament darstellt.
Das glaube ich nicht
Es gibt eine (dümmliche) Fernsehsendung, in der nach Fussballänderspielen in einer Art Stammtisch mit Gästen über das Spiel geredet wird. Der Einspielfilm zu dieser Sendung ist allerdings fast genial. Da kommen Altherrenfussballer angelaufen, spielen Fussball und der Moderator gibt seine Bemerkungen ab (»den macht doch meine Oma«). irgendwann spricht einer der Spieler ihn mal an: »Spielst auch mal mit?« Und dann die Antwort: »Na, i red bloss drüber« (soll bayerisch sein).
Das tangiert in gewissem Sinn das Wesen der Kritik (und ist einer der Hauptvorwürfe gegen sie): Sollen sie’s doch bessermachen. Ich glaube, die meisten Kritiker wären lausige Romanschreiber. Was sie aber nicht per se disqualifiziert festzustellen, dass da was nicht stimmt (das es ihnen nicht gefällt – also eine Geschmackskritik – lasse ich nicht gelten; das ist in der Tat zu billig). In diesem Fall greife ich immer zum Lessing-Wort: Ich muss nicht Koch sein um festzustellen, dass die Suppe versalzen ist.
Lange Rede – kurzer Sinn: Ich kann keine Romane, keine Erzählungen schreiben.
So einfach kaufe ich Ihnen das nicht ab, dass sie keine Romane, keine Erzählungen schreiben könnten. Um beim Beispiel der Suppe zu bleiben, Sie kennen die Zutaten und Sie kennen das Ergebnis. Also bleibt nur doch die Zubereitung, bei der sie möglicherweise Schwierigkeiten hätten. Aber sehen Sie, ein Feinschmecker wie Sie bringt im Laufe der Jahre gewisse Grundkenntnisse über Zubereitungsarten mit. Der Feinschmecker weiß schon, dass man einen Brotlaib nicht in Wasser kocht, Salat nicht durch eine Kaffeemühle treibt, und ein schmackhafter Weichkäse nicht durch Frittieren in der Bratpfanne entsteht.
Oder anders gesagt, vom Ergenbis lassen sich ja gezielt Rückschlüsse ziehen auf die Zubereitung. Wo etwas versalzen ist, nimmt man weniger Salz, wenn das Brot zu stark gebräunt ist, reduziert man die Hitze, wenn der Braten halbgar ist, dann wird er noch ins Rohr beschoben, wenn der Teig zu wenig geknetet wurde, so erhöht man die Knetzeit.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie als Feinschmecker in der Szene der Buchvorstellung über keinerlei Kenntnisse der Zubereitung verfügten.
Edit: Wenn Sie allerdings sagen, dass sie als begeisterter Leser lieber die Bücher anderer vorstellen, als selbst eines zu Schreiben, das nehme ich Ihnen sofort ab.
»Ich kann keine Romane, keine Erzählungen schreiben.« – Ich vermute, das gilt für die meisten Kritiker. Umgekehrt geben die wenigsten Schriftsteller gute Kritiker ab. Was Goethe von Kleist hielt, oder was Thomas Mann über die anderen Schriftsteller seiner Familie schrieb, oder was Peter Hanke so in diversen Interviews über Schriftstellerkollegen äußerte, das zeigt m. E., dass Schriftstellern offensichtlich die nötige Distanz fehlt, um persönliche Animositäten, Geschmacksurteile und Rivalitäten beiseite zu lassen, um brauchbare Kritiken schreiben zu können.
@rosenherz
Ihre Bildfortführung ist verführerisch. Um da weiterzumachen: Wenn Sie statt des Rezept eines komplexen Gerichts nur die reinen Zutaten kennen (ohne Mengenangaben), so ist die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas geniessbares herauskommt, was auch noch einen gewissen Anspruch hat, sehr gering.
@MMarheineke
Handkes Besprechungen sind selten, aber fast alle sehr gut (nachzulesen u. a. in »Meine Ortstafeln – meine Zeittafeln« Essays 1967–2007) und im übrigen nie Verrisse.
Seine »Ausreisser« gibt er in Interviews. Und da über Autoren, die er nie bespricht.
Wie versprochen...
meine paar Anmerkungen. Wobei Du hier in der Langversion einiges schon selbst einräumst (z.B. was den Individualismus in der westlichen Literatur betrifft – den gibt es nicht nur angeblich, wie ich meine. Liegt doch nach unserem Massstab auf der Charakterentwicklung gleich viel Gewicht wie auf dem Plot, wenn nicht noch mehr).
Rushdie ist im Wesentlichen ein orientalischer Märchenmagier (mit einem very British Humor, der lässt sich auch schlecht übersetzen). Im orientalischen Erzählen ist die Tiefe der Protagonisten, im Gegensatz zu unserer westlichen Literatur, die den Hyperindividualismus wiederspiegelt, weitgehend nebensächlich. Auch in 1001 Nacht sind die Figuren meist austauschbar (wobei ich beispielsweise den Akbar durchaus vielschichtig finde). Es geht viel mehr um den bunten Teppich, das Geschichtengewebe, die Menschen als soziales Geflecht, um Naturallegorie, Liebe und Krieg, ums Maskenspiel – womöglich das, was Du Pappmaché-Märchenwelt/kulissenschieberisch nennst. Orientalisch heisst auch: breiter und langsamer; für uns mit unserem zackigen Tempo kann das langatmig wirken.
Genau diese Vorwürfe tauchen in deutschsprachigen Rezensionen über orientalische Bücher immer wieder auf (etwa Pamuk, oder neulich wieder Schami). Oder so wie Rushdies »Shalimar« verrissen wurde, weil er als Beitrag zur aktuellen Terrorismusdebatte gewertet wurde, was falscher gar nicht sein könnte. Rushdie zeigt ja gerade auf, was viel fundamentaler menschlich ist, den Kaffeesatz unter den Oberflächlichkeiten wie Bombenlegerei – »Politik« in all ihren Spielarten ist ja nur das Schäumchen obendrauf. Kaffeesatz-Bücher werden leider oft für zu leicht befunden; aber es sind die Schäumchen-Bücher (also z.B. die gesamten 9/11-Romane), die die Geschichte nicht überdauern werden.
Übersetzer gehen dem Eurozentrismus vielleicht auch auf den Leim, wer weiss? Ich habe meine ersten 2 Rushdies auf Deutsch gelesen (von 2 unterschiedlichen Übersetzern) und fand zumindest einen davon ganz schlecht. Ein Glück, habe ich mich deswegen nicht von Rushdie abgewandt. Zur Übersetzung der Enchantress kann ich nichts sagen, möchte dem Übersetzer (der glaube ich nochmals ein anderer ist) gar nichts unterstellen.
Ich kann in dem Buch wenig L’art pour l’art erkennen (soweit es nicht dem orientalischen Erzählen geschuldet ist, siehe oben). Das Hintergründige, Doppelbödige vermisst man nur dann, wenn man »Magischen Realismus« (im weiten Sinne) sozusagen als Genre betrachtet mit der Haltung »es ist ja nur eine Geschichte«. Ich gebe zu, dass ich diesbezüglich ein Extremist bin, aber: ich nehme solche Geschichten für wahr, weil sie meiner Erfahrung und Wahrnehmung entsprechen. Tut das ein Leser, der nicht so wahrnimmt, dann wird die Gefährlichkeit des Buches offensichtlich: es gibt diese künstlichen Grenzen zwischen Hüben und Drüben nicht. Allein die Beziehung zwischen Qara Köz und dem Spiegel beispielsweise könnte einen bei näherer Betrachtung in den Wahnsinn treiben. Oder auch die Figur des Argalia, Tulpenprinz, der wie eine Frau lieben und wie ein Mann töten kann. Jodha, die gar nicht existiert (?), ist plastischer als die existenten Frauen Akbars (und gar nicht ausschliesslich von seiner Phantasie abhängig – es gibt Ansätze zur Emanzipation). Der Maler, der in seinem Bild verschwindet. Oder der Elefant, dessen Zorn daher rührt, dass er mit einem »falschen« Namen ausgestattet wurde. Oder die Alraune ... Das sind alles Figuren – ich seh nichts Hölzernes. Das Kostüm gehört zum Fleisch dazu, manchmal ist die Maske das wahre Gesicht. Nackte Figuren sind doch langweilig.
Ich weiss, Du weisst, dass Rushdie einer meiner Olympier ist. Das schrie nach Verteidigung.
Trotzdem: Er hat den Shalimar damit nicht getoppt, wie ich in der ersten Hälfte dachte – mir hat nämlich gerade der Florenz-Teil nicht mehr so gefallen wie das Üppige und Phantastische am Hof des Mughals.
(Waren wir uns schon jemals so uneinig?! :-) )
Wenn jemand eine Geschichte erzählen will, in der die Tiefe der Protagonisten nicht erzählt wird (unwichtig kann sie eigentlich nie sein – dazu später), dann ist das in Ordnung. Aber sie – die Tiefe, das Doppelbödige in der Person (oder dem Ort) – muss sich dann dem Leser durch das Handeln herauskristallisieren und erschliessen. Es muss nicht in tiefgründigen Reflexionen »behauptet« werden (viele schlechte Romane agieren so), es muss auch nicht in pseudo-reflexivem Tiefgang geschürft werden (was Rushdie mit Akbar macht, der dadurch eine angedichtete Vielschichtigkeit bekommt, die arg klischeehaft wirkt). Anderen Vertretern des »magischen Realismus« wie z. B. Garcia-Marquez gelingt das sehr wohl. Die Figuren bekommen ohne individualistische Ausdeutung eine Tiefe, die dem Leser aber – und das ist ein Gewinn! – nicht eindeutig erscheint, sondern eventuell noch gebrochen wird. In gewisser Weise ist dies auch bei Ivo Andrić der Fall (natürlich denke ich nicht nur an die Erzählungen sondern an der »Brücke über die Drina«). Andrić ist ein gutes Beispiel, wie »orientalisches Erzählen« in – ich weiss, das ist ein Schimpfwort, mir fällt aber kein besseres ein – »modernes« Erzählen eingebettet werden kann, ohne auf Doppelbödigkeit und Tiefe verzichten zu müssen (wobei ich Andrić nicht als »magischen Realisten« sehe; aber solche Etiketten sind eh problematisch, ich verwende sie nur aus Gründen der Vereinfachung).
Von einem »breiter und langsamer« merke ich bei Rushdie nichts; eher ein zäh und langatmig. Genau nichts Episches, weil alle Leerstellen mit Fabulieren ausgefüllt werden. Ich finde weite Teile des Buches exakt das Gegenteil von Phantasie anregend, sondern eher Phantasie austreibend.
Die Sache mit den Übersetzern ist schwierig. »Shalimar« ist auch von Robben übersetzt; davor gibt es andere Übersetzer/innen. Ich frag mich immer, warum dies so ist, zumal die letzten Bücher alle bei Rowohlt erschienen sind. Ein »nobody« ist Robben nicht.
Die Beziehung zwischen Qara Köz und Spiegel finde ich arg strapaziert. Zunächst meint man, es handele sich um ein und dieselbe Person (ähnlich wie Jeckyll/Hyde), aber als sie in Weinfässern aus Florenz fliehen wird spätestens klar, dass es zwei sind. Und eines der Geheimnisse hat ja mit »Spiegel« zu tun (ich verrate da nicht). Ich finde das eher konventionell erzählt: Spiegel bereitet Qara Köz die Herren für das Liebesspiel vor und wenn diese keine Lust hat, dann »springt« sie auch mal ein.
Diese Jodha, die Rushdie als imaginäre Frau darstellt, hat wohl auch tatsächlich existiert (es gibt sogar einen Bollywood-Film darüber). Indem im Buch diese Existenz als »virtuell« (Klappentext) dargestellt wird, wird ein Geheimnis hineinprojiziert, was den Leser (= mich) kalt lässt. Imaginiert nicht jeder Mann eine »Traumfrau«, die er nie »bekommen« wird? Allerweltspsychologie.
Ich will natürlich keine »nackten Figuren«; die sind in der Tat langweilig. Aber wenn unter dem Kostüm, der Maske nichts mehr ist (und das Nichts weniger als Nacktheit ist)? Ein Maskenball ist nur interessant, wenn ich die Menschen hinter den Masken wenigstens andeutungsweise glaube zu kennen. Was ist ein Kostümfest ohne die Überraschung, wer sich in welchem Kostüm verkleidet hat?
Wir hatten vor einiger Zeit eine kleine private Diskussion über den »Turm« von Tellkamp. Du hattest sinngemäss geschrieben, dass Dich die DDR-Thematik nicht interessiert und Du ihr aus dem Weg gehen möchtest. Das ist natürlich Dein Recht. Ich habe auch solche Themenkreise, über die ich eigentlich nichts (mehr) lesen möchte – sei es in der Hybris, alles schon zu kennen, sei es, weil man durch Wiederholungen gelangweilt wird und neue Aspekte nicht greifbar sind.
Dennoch durchbreche ich gelegentlich solche Vorsätze (sei es halbwegs »erzwungen«, sei es aus Neugier). Und oft genug habe ich festgestellt: Wenn der Autor sein Handwerk (sic!) versteht, dann interessiert mich plötzlich auch das Leben eines Buchhalters in Portugal oder ein Bildungsbürger, der in einer Kurklinik schlichtweg »hängenbleibt«. Das macht ja gerade den Zauber von Literatur aus.
Aber wenn das Geschichtenerzählen alleine schon reicht – sorry, das ist mir zu wenig. Egal, ob die Figuren fliegen können, obszöne Zoten erzählen oder den Leuten die Köpfe abschlagen. Das ist dann pure Illustration.
Vielleicht kennst Du Eugen Drewermann. Der ist nicht nur Kirchenkritiker, sondern auch Psychoanalytiker. Ich habe neulich eine Radiosendung gehört, in der er Märchen (der Gebrüder Grimm) psychoanalytisch gedeutet hat. Ich kann und will mich zu der Qualität dieser Deutungen nicht im Detail äussern (vieles halte ich für weit hergeholt). Aber eines bleibt festzuhalten: Die Märchen gaben diese Deutungen her. Drewermann saugte sich seine Exegesen nicht aus den Fingern, sondern fand immer wieder Anknüpfungen im eigentlichen »Text«. Ich glaube, dass er bei diesem Rushdie Buch nicht so fündig würde. Das meine ich mit »L’art pur l’art«: Die blosse Geschichte genügt nicht, damit es Literatur ist.
Noch etwas zum Politischen: Ich glaube, dass grosse Teile der Literaturkritik Rushdie aus politischen Gründen nicht »verreissen«. Seit den »Satanischen Versen« gilt er einigen als Dummy für die Meinungsfreiheit. Ausserdem sind seine Bücher exotisch und kontrastieren tatsächlich mit der fast üblichen Lakonik. Wirkliche »Fans« (wie Du eine bist) dürfte es deutlich weniger geben; man hält sich nur zurück.
Eine schoen ueberzeugend beschriebenes Buch
das ich wahrscheinlich nicht einmal in den dritten Steamer Trunk
auf dem Tramp Steamer packen werde. Hier in der USA hab ich
hauptsaechlich Verrisse gelesen, keine von denen sich die Bemuehung
einer Beschreibung leisteten, und deswegen dem moeglichen Kaeufer auch nicht im geringsten behilflich sind. Ich erinnere mich, das jetz schon vor vielen Jahren, als er noch der Verleger des Holtzbrinck Verlags Holt in New York war, Michael Naumann mit einigen Millionen den Rushdie zu sich geholt hat. Es gibt ein Interview mit R. in der Zeit
Das Interview ist hier.
Und hier eine schöne Glosse von iris Radisch über die grassierende Unsitte, mit Schristellern über ihre Bücher zu sprechen. Was die ZEIT natürlich nicht davon abhält, dies permanent selber zu tun...