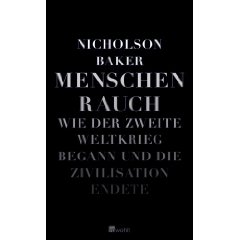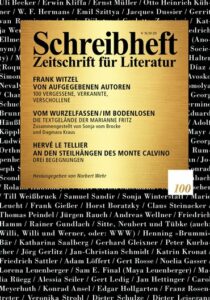
Das Schreibheft von Norbert Wehr feiert heuer die 100. Ausgabe. Zum Jubiläum gibt es einen umfangreichen Essay von Frank Witzel über »100 Vergessene, Verkannte und Verschollene«. Erinnerungen kommen auf an Michael Helmings wunderbare Reisen zu fünf vergessenen osteuropäischen Schriftstellern und seine »Kontaktaufnahme« an deren Gräbern. Witzel bekommt für seine 100 Hinweise (es sind mehr, weil zum Beispiel aus Lexika zitiert wird, die ein ähnliches Anliegen verfolgten) 128 Seiten. Überwiegend sind Schriftsteller gemeint, auch wenn es eine kleine Rubrik über Zeichner und bildende Künstler gibt. Witzels Auswahl ist subjektiv und daraus macht er keinen Hehl. So erklärt er auch häufiger, wie er auf diesen oder jene gekommen ist, findet fast immer die biographischen Daten und es werden häufig auch (längere) Ausschnitte abgedruckt. Es findet sich Originelles, Konzeptuelles und Skurriles (etwa ein Hinweis auf einen Autor, der Rezensionen über nicht existierende Bücher verfasste); Gedichte, Prosa, Drama, Dialoge, Interviews, Collagen. Manches Mal ertappt man sich dabei, dass die Verschollen- und/oder Verborgenheit gar nicht so schlecht gewesen ist, aber das ist natürlich ebenfalls subjektiv. Vielleicht sollte man das Konvolut nicht in einem Stück lesen.
Die Frage, die Witzel sich und den Leser immer wieder stellt: Warum wurde jemand mit einer zuweilen in seiner Zeit durchaus beachtlichen Publikationstiefe irgendwann schlichtweg vergessen? Die Gründe können viele Ursachen haben. Texte wie der von Witzel (aber auch Helming) sollen zeigen, dass sie nichts oder nur sehr wenig mit der Qualität des jeweiligen Werks zu tun haben. Häufig findet Witzel den Fehler beim jeweiligen Autor, etwa wenn es sich um übertriebene Perfektionisten handelt, die niemals fertig werden. Oder sie verlieren nach den ersten Misserfolgen schlichtweg die Lust (einher geht damit zumeist auch der Verlust des Verlags).