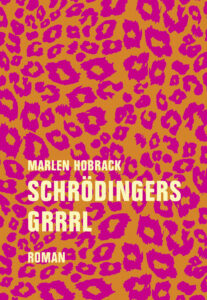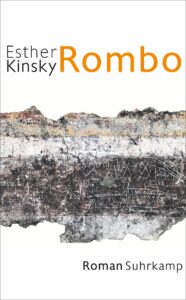Theorie des Regens
Notizen, Aphorismen, kurze Ereignissplitter oder einfach nur Erschautes und Reflexives von Alltäglichem: in den letzten Jahren zieht mich diese Form von Literatur immer mehr an. Der »große Roman«, die kunstvolle »Short-Story« – schon recht. Aber manchmal spürt man zu sehr den Willen oder auch den Widerwillen des Autors, eine Geschichte vorantreiben zu müssen. Dieser Zwang entfällt in dieser Kürzestprosa (die freilich andere Fallstricke aufweist).
Rothmanns Notizen mit dem lyrischen Titel Theorie des Regens umfassen den Zeitraum von 1973 bis 2023, also satte fünfzig Jahre. Dabei zeigen die nur etwas mehr als 200 Seiten, dass hier eine Auswahl vorliegt. Die Eintragungen sind chronologisch, aber ab und zu stockt die Zeitfolge und Rothmann beginnt zu bilanzieren, sich mit dem heutigen Wissen zu erinnern, etwa wenn er »das kalte, taschensoziologische Menschensortieren in der Literatur dieser frühen achtziger Jahre« kritisiert, übrigens, wie er bekennt, »auch zwischen meinen Zeilen«. Manchmal werden, so hat man das Gefühl, bewusst Jahreszahlen eingefügt, damit der Leser einen Überblick erhält.
Der Vorteil des nicht sonderlich mit dem Werk vertrauten ist die Unvoreingenommenheit, mit der man die Lektüre begeht. 1973 ist Rothmann 20 Jahre alt, lebt im als eng empfundenen West-Berlin und ist praktisch mittellos. Es ist die Zeit der »Geburt des Erzählers aus der Lieblosigkeit«, »befangen in einer manischen Augenblicklichkeit«. Für 600 Mark stellt er sich als Strohmann für einen Autokäufer im Iran zur Verfügung und macht sich mit anderen Strohmännern und einem Käufer auf den Weg nach Teheran. Es ist eine von mehreren Reisen, die atmosphärisch dicht skizziert werden. So wie dieser Amerika-Trip zehn Jahre später, mit Aufenthalten in New York, Mexiko-City, Tijuana, Acapulco, schließlich Ecuador und Peru (zu Zeiten des »Leuchtenden Pfad« gefährlich). Umwerfend darin die Episode einer Gebirgstour mit dem furzenden Fósforito, dem seinerzeit klügsten Pferd in Ecuador; eine Geschichte mit einer mystischen Pointe.