Mara Wolf ist zu Beginn von Marlen Hobracks Roman Schrödingers Grrr 23 Jahre alt. Der Titel ist Maras Pseudonym auf Instagram; ihre Faszination zur populären Deutung des Quantenphysik-Problems »Schrödingers Katze« ist derart, dass sie schon auf der ersten Seite ihren Briefkasten zu »Schrödingers Giftbox« erklärt – mit all den Rechnungen, Mahnungen und Behördenschreiben, die real sind und zugleich irreal erscheinen, sobald der Kasten geschlossen ist. Mara Wolf ist mit 15 als Einser-Schülerin von der Schule gegangen (warum, erfährt der Leser gegen Ende) und verbringt ihren Tag mit einem merkwürdigen Kater, den sie »Psykater« nennt, in einer kleinen Wohnung in Dresden. Der Vater ist tot, ihre Mutter führt eine Art Messie-Dasein; gelegentliche Besuche der Tochter erschöpfen sich in gegenseitigem Einandervorbeireden beim Fernsehkonsum und der Feststellung des Mottenbefalls bei den Lebensmitteln der Mutter. Maras Leben ist »ein tägliches Scheitern«. Es sind Zeichen einer veritablen Alltagsdepression, die zeitweise von borderlineähnlichen Euphorien abgelöst werden. Aber die Depressionen sind das einzige, was Mara Wolf tatsächlich gehört, wie sie keck betont und daher Hilfe ablehnt.
Ihr Traum ist eine Influencerkarriere bei Instagram, aber vorerst ist sie eher selber Kundin und leidet darunter, die angesagten Makeups aus Geldmangel nicht kaufen zu können. Die billigeren Sachen klaut sie bisweilen mit einem cleveren Trick aus dem Supermarkt. Alarm ist bei ihr, wenn sie sich zu einem Termin beim Jobcenter einzufinden hat, aber Frau Kramer ist verständnisvoll und umgänglich. Besonders besorgt ist Mara um ihr Aussehen; jede Hautunreinheit stürzt sie in Reparaturarbeiten; Dehnungsfalten versetzen sie in Schrecken. Das Körpergewicht möchte sie derart regulieren, dass sie von Größe 38 auf 36 kommt; die Beckenknochen zeigen ihr irgendwann an, dass das Ziel erreicht hat und demnächst unterschreiten wird.
Ihre Freunde sind (unter anderem) Mark vom Netto-Markt, der mit seinem Asperger die Getränkeverpackungen sortiert, die chaotische Charis und der »Fuckboy« Robert, der Mann, der zu nichts verpflichtet. Über Charis lernt Mara Ben kennen, einen Lyriker, der den Kapitalismus durch »Subsistenzwirtschaft« ersetzen möchte und der sie nicht mag. Ben hat eines Tages Paul zu Besuch, einen 29jährigen Museumwärter aus Liverpool, der fasziniert ist von südamerikanischen Kakerlaken und in den sich Mara schon bei der Ankündigung eines gemeinsamen Treffens der Clique über seine Facebook-Bilder verbliebt hat und nun alle Register zieht, um ihn für sich zu erobern. In einer euphorischen Phase entschließt sie sich therapeutische Hilfe anzunehmen und trifft sich nun jeden Freitag bei Herrn Dr. Köhler, ihrem »Kummerkasten«.
Irgendwann wird sie von einem Hanno Thalmayr (59), seines Zeichens »Agent«, nach Berlin eingeladen, tritt dort stilgerecht in Leopardenleggins auf (Cover!) und nach der Einnahme einer weißen Pille mutiert sie zur rasanten »Unterschichtentänzerin«. Hanno ist begeistert und macht ihr zusammen mit Lektor Jürgen ein Angebot: Sie soll als Fake-Autorin für einen Roman fungieren, den ein »alter weißer Mann« geschrieben hat, der aber mit dessen Vita nie erfolgreich würde. Die Modalitäten sind verlockend; sie zögert, hat keine Ahnung vom Literaturbetrieb, ist nahezu unbelesen, aber »Stolz muss man sich leisten können«. Der Roman muss nur noch umgeschrieben werden und soll in achtzehn Monaten erscheinen. Über das Ausmaß dessen, was auf sie wartet, ist sie sich nicht im Klaren. Am unwichtigsten dabei ist noch, dass sie von Hanno ab sofort »Püppi« genannt wird.
Marlen Hobrack inszeniert derweil die Liebes- bzw. Nichtliebesgeschichte zwischen Mara und Paul, ihre erotisch aufgeladenen WhatsApp-Messages, die mit der Realität in Liverpool dann auf Crashkurs gehen aber von Mara später zu einem »wachsendes Liebestext« ausgedruckt werden und ihrer Schmacht dienen. Das ist insbesondere was die Liebesschwärmereien Maras angeht ausufernd und detailreich erzählt, aber dem Leser soll die Zeit bis zur Buchvorstellung verkürzt werden. Zwischenzeitlich lernt Mara – auf dessen Wunsch – den Autor des Buches, einen gewissen Benjamin Richter, Mitte 50, kennen. Der ist begeistert von ihr; sein Lebenszweck scheint darin zu bestehen, ein Mal die Literaturbubble zu foppen.
Mara Wolf pendelt zwischen Depression, Geldnot, Liebeskummer (Paul ging wegen Maras »Bedürftigkeit« auf Distanz – die Entliebungsszene ist großartig), Katerkrankheiten, Psychoanalyse und nimmt, um dem Druck des neuen Jobcenter-Betreuers zu entkommen, einen Job als Putzhilfe an – in dem Unternehmen, in dem auch ihre Mutter arbeitet. Nach einer Einarbeitungszeit gefällt ihr sogar die Arbeit; der ätzende Geruch der Bleiche für die Toilettenreinigung weckt in ihr das Gefühl von Reinheit.
Langsam aber sicher steuert der Roman auf seinen Höhepunkt zu: Die Veröffentlichung des Romans »von« Mara Wolf. Einen Titel erfährt man nie; lediglich ein paar Sätzchen werden zitiert. Mara Wolf tritt im Roman als Mara Wolf auf. Entgegen ihren eigenen Befürchtungen schlägt sie sich in ihrem »Rollenspiel« sehr gut, verinnerlicht rasch die Attitüden einer in den Medien stehenden Autorin. Schnell inkorporiert sie auch Richters Ratschlag, dem Publikum (und auch den Feuilletonisten) zu suggerieren, der Text sei autobiographisch – und gleichzeitig diesen Sachverhalt kategorisch von sich zu weisen. Mara genießt den Ruhm und die Lesereisen mit Übernachtungen in Drei- oder Viersternehotels. Die immergleichen Kinderfragen der Journalisten kann sie mit routiniert-gelernten Antwortschablonen bedienen. Das wird unterhaltsam erzählt; nichts davon erscheint übertrieben oder unglaubwürdig. Auf Beispiele von Autorenfälschungen (z. B. Binjamin Wilkomirski oder, weniger gravierend, die Enttarnung des Pseudonyms »Aléa Torik«, hinter dem sich statt einer jungen rumäniendeutschen Emigrantin der fast 20 Jahre ältere Deutsche Claus Heck zeigte) wird verzichtet.
Einer der Höhepunkte ist ihr Auftritt auf einem »Festival der Vielfalt«. Kurz zuvor hatte man Mara den Preis für das beste Debüt des Jahres zugesprochen. Vor einem dezidiert linken Publikum wird sie nach ihrer Lesung jedoch mit Vorhaltungen konfrontiert, die sie beim klassischen Buchhandelspublikum noch nie gehört hat: Sie reichen von »radikalem Antiintellektualismus« über »Klassismus« (in Bezug auf die Schilderung des Jobcenter-Publikums), dem Vorwurf der Männerdiskriminierung bis hin zur »heterosexuellen Zwangsmatrix« der Prosa.
Die Einwände an die Fake-Autorin könnte man mit einer guten Portion Böswilligkeit und literarisch-ästhetischen Ahnungslosigkeit auch auf Hobracks Roman selbst anwenden. Es ist der in vielen Stellen im Buch praktizierte fast geniale Zug der Autorin, die Klischees und Schablonen, die sie (bzw. ihre Protagonistin) erkennen – vor bzw. im Jobcenter, auf einer Party in Berlin, in der Begegnung mit dem tatsächlichen Autor im Cord-Jackett oder bei der Premierenlesung – sofort auch als solche benannt werden. Damit erfolgt eine sofortige Immunisierung für den aus dem Ruder laufenden literarischen Realismus. Für Exegeten dürfte es zudem spannend sein zu analysieren, wann Mara Wolf im Buch direkt als »Ich« erzählt und wann eine personale Erzählform gewählt wird.
Das Ende soll hier nicht erzählt werden, außer dass Psykater das Schicksal von Jim Morrison erleidet und die Beerdigung zu einem fast poetischen Akt hätte werden können. Zuweilen reißt der Roman Themenfelder auf, um sie danach sofort wieder zu begraben. Da wird über Erinnerungen philosophiert (»Erinnerung ist das Abrufen von Erinnerung«), über Essstörungen, Messie-Symptome, Social-Media-Sucht und das Unverständnis der Mittfünfziger über diese Medien generell (Herr Köhler; Bernhard Richter), die prekären Beschäftigungsverhältnisse (Supermarkt; Reinigungskräfte), Fernbeziehungen (Zitat Kafkas aus Brief an Felice Bauer!) oder den Unterschied zwischen Trauer und Melancholie (Freud hilft dabei). Bisweilen werden Superlative gewählt, die nicht zu passen scheinen: Mara gerät nicht Panik, sondern es ist sofort eine »Panikattacke«, der Kuchen beim Frühstück ist nicht süß, sondern verschafft ihr einen »Zuckerschock«. Vieles kommt nachträglich als Dekoration daher, changiert mitunter ins unfreiwillig komische. Andere Anspielungen verpuffen, wie etwa das Geschenk eines David Foster Wallace-»Büchleins« von Hanno an Mara oder der Selbsthass ihrer »makelbehaftete[n] Existenz«. Fünf Minuten später ist dann alles wieder gut.
Gelungen bleibt die sanfte Karikatur des Schreibbetriebs und dessen mediale Verhunzung speziell durch das Fernsehen. Insgesamt weist der Roman die vom Literaturwissenschaftler Moritz Baßler postulierte »offene Zukunft« auf und erfüllt damit zugleich literatur-ästhetische wie auch populär-unterhaltende Kriterien. Letztere würde ihn prädestinieren zur Bearbeitung für den »Film-Mittwoch im Ersten« oder dem »Fernsehfilm der Woche« im ZDF. Die zweifellos vorhandenen literarischen Qualitäten des Romans würden dabei vermutlich liquidiert. Der Genießer bleibt beim Roman.
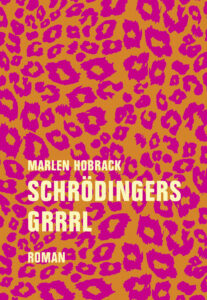
Besten Dank für diese bemerkenswerte Besprechung.
Zitat: »...eine sofortige Immunisierung für den aus dem Ruder laufenden literarischen Realismus«.
Musste ich ein bisschen überlegen. Realistisch, heißt doch in diesem Zusammenhang: leicht vorstellbar, plausibel, vertraut. Wenn man sich das Leben einer jungen Schriftstellerin vorstellt, würde man diesen Roman als erste Wahl sortieren. Aber dann wäre der sog. Realismus doch ein sehr oberflächlicher Effekt, der aus dem Verschnitt von Autorenleben und Wirklichkeitselementen herrührt. Man könnte auch Tagebuch führen, und das Ganze ein bisschen fiktiv aufschäumen. Das wäre die adäquate Form. Soll heißen: ist ein Schriftsteller-Roman aufgrund der beiden Ich-Funktionen nicht von vorne herein super-realistisch?! Man müsste doch sprichwörtlich phantastische Mittel einsetzen, um den Leser von der allgegenwärtigen Suggestion abzuhalten...
Ein Zweites: die Geschichte bildet doch eine Distanzierung von der Öffentlichkeit ab, wenn ich das richtig verstehe. Ja, da gibt es Auftritte, Kontakte, Lesungen, etc. Aber liegt darin nicht mehr als eine ironische Brechung?! Ich glaube, die Autorin würde sich gerne verstecken, kennt aber auch die »Regeln des Spiels«, und entschließt sich daher, den Konflikt auf einer fiktionale Ebene zu lösen. Wie kann man heutzutage ein unbeschwerter Autor sein, wenn nicht als Ghostwriter?! Das ist mehr als Ironie, das ist Kulturkritik.
Mit »Realismus« ist der der Effekt der Vorhersehbarkeit, des wohlsituierten Klischees gemeint. So ist der »alte, weiße Mann« in Cordanzug natürlich sehr leicht als (nicht ganz so erfolgreicher) Günter-Grass-Verschnitt zu interpretieren, usw. Indem Hobrack selbst auf diese eingängige Typisierung hinweist, nimmt sie der Kritik den Wind aus den Segeln (und erleichtert mir die Lektüre).
Für einen kulturkritischen Impetus ist mir der Roman zu brav. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Autorin Journalistin und Kolumnistin ist, und zwar, wie bei dem Verlag nicht anders zu erwarten, dezidiert links. (Hier ein Text von ihr über »Klassismus«, der die klassischen [!] Symptome des aktuellen »Diskurses« über Diskriminierung enthält und daher unendlich langweilig ist; der Roman ist besser.) Sie möchte gar vermutlich keine Kulturkritik üben – das wäre zu sehr »abgehoben«, sondern bleibt bei den politischen Verhältnissen.
Oh, eine Gerechtigkeits-Mamsell, dann freilich kann sie gar kein kritisches Potenzial haben, sondern nur affirmativ denken. Wer in einem Essay ernsthaft den Begriff »Diskurs« benutzt, befindet sich sowieso in geistiger Dauer-Quaratäne. Das ist sehr schade, denn ich hatte ein bisschen Mitgefühl mit dem jungen Ding. Ich stelle mir die geistig-moralische Verlorenheit der jungen Menschen immer sehr dramatisch vor. Vielleicht, weil ich es so erlebt habe?! – Entzückend, wenn dann die Kolumnisten auch noch die »Anstrengung des Begriffs« auf sich nehmen, und die Klasse zum Bezugspunkt einer Reflexion über die leerlaufende politische Gerechtigkeits-Kommunikation wählen. Das klappt ja so rein gaaar nicht... Das Durchstechen der wichtigen wichtigen Anliegen!
Eine ernsthafte Frage: was ist so schlimm am Klischee?! Es ist das zentrale Element der Komödie. Die komödien-feindlichen Tendenzen in der Literatur würde ich (frech!) als die verzweifelte Bitte um Anerkennung der eigenen »moralischen Ernsthaftigkeit« von Autorinnen/Autoren deuten.
Die wahre Welt gering zu schätzen, – wir hätten im Moment so viel Grund. Aber im Ernst: gibt es eine »Konfrontation« des Romans mit der Komödie, schon aus theoretischer Sicht?!
Das Klischee in der (guten) Komödie wird nicht nur genannt, sondern auch immer irgendwie »verpackt«, sei es ironisch, sarkastisch oder einfach nur humoresk; im Idealfall wird es durchbrochen, aber nicht so, dass plötzlich nur das Gegenteil gilt. Das Klischee als bloße Abbildung bzw. als Typisierung von jemandem ist trivial, weil es die x‑te Wiederholung des Bekannten ist. Man könnte es als Denkfaulheit desjenigen apostrophieren, der es verwendet.
Ich glaube, dass ein guter, komödiantischer Text eine Königsdisziplin der Literatur ist. Daher gibt es so wenige. Ich erinnere mich an eine Kritikerrunde (damals mit Reich-Ranicki), in der das einmal thematisiert wurde. Als letzte herausragende Komödie deutscher Sprache wurde dort »Der zerbrochene Krug« von Heinrich von Kleist genannt.
Ich habe versucht, Hobracks Roman ohne das »Klischee« der linken Journalistin zu lesen.
Ja, diese Intuition hatte ich auch. Das Klischee stört sofort, wenn es nicht in einem »humoresken Milieu«, und sei es nur ein Kapitel lang, eingebettet ist. Bleibt gar nichts anderes übrig, als es sofort zu ironisieren (da ja auch sonst kein »Gedanke« vorstellig wird, Stichwort Faulheit...), will sich der Autor nicht lächerlich machen. Das ist fast schon eine handwerkliche Pflicht.
Dabei ist die Autorin selbst ein Klischee, Sie sagen es. Das ist nun definitiv lustig. – Ihre Rezension ist überaus fair. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach die Hobrack von einem wirklich gelungenen komödiantischen Text. Zu viel »Klassenerfahrungsbericht«?! Zu wenig Talent im Klein-Werden (Deleuze)?!
Ich habe in meinem Text ja nicht das Ende erzählt. Die Sache mit dem Fake kommt natürlich ‘raus – und zwar weil der »alte weiße Mann« nicht stillhalten kann, der jungen »Autorin« den Erfolg nicht gönnt und an die Öffentlichkeit geht. Sie zieht sich also zurück, im Briefkasten ist nur noch eine Karte und im Jobcenter ist Frau Kramer wieder zurück (der Kollege mit dem tollen Stuhl, der Mara härter »rannehmen« wollte, ist weg). Friede, Freude, Eierkuchen.
Schwer zu sagen, wie man es hätte besser machen können. Ich habe den Roman gerne gelesen. Was den Literaturbetrieb angeht, trifft sie manchmal ins Schwarze. Die Erleichterung, ihm nicht mehr anzugehören, ist verständlich. Und hier scheiden sich eben Figur und Autorin. Letztere ist »drin«. Vielleicht ist das ja die Pointe, fällt mir gerade ein.