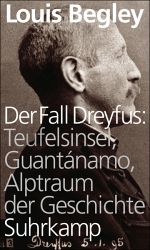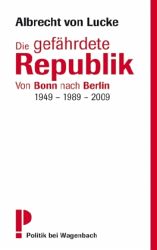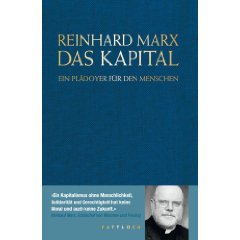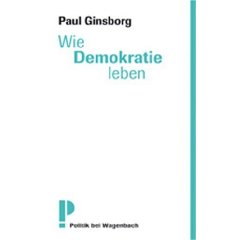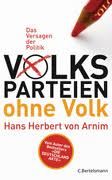
»Das Versagen der Politik« will Hans Herbert von Arnim in seinem Buch »Volksparteien ohne Volk« – ja, was? – auflisten, entwickeln, enthüllen? Aber außer ein paar Bemerkungen über die Subventionspolitik zur ansonsten eher als Bastion des freien Marktes auftretenden Europäischen Union und einer zweitklassigen Politikerschelte hinsichtlich ihrer Versäumnisse was die aktuelle Finanzkrise angeht, erfährt man über ein potentielles Politikversagen kaum etwas.
Denn so weit kommt von Arnim einfach zu selten, weil er nur zwei große Themen hat: Parteien- und Politikerfinanzierung und das Wahlrecht, welches, so die These, den Volkswillen nicht nur nicht ausdrückt, sondern ignoriert. Auch wenn einem diese Themenbeschränkung als Gründe für eine immer weiter behauptete Politikverdrossenheit ein bisschen eindimensional erscheinen – warum nicht neue Argumente lesen, die dann vielleicht jene Untersuchungen relativieren, die in mangelnder Konsistenz der Politik (beispielsweise durch allzu anbiedernde Ausrichtung der Programmatik an jeweils aktuelle Umfragetrends) als Hauptgrund für eine sich breitmachende Politikmüdigkeit ausmachen?