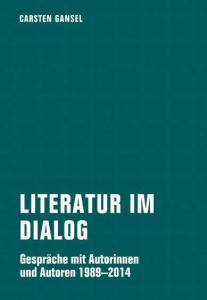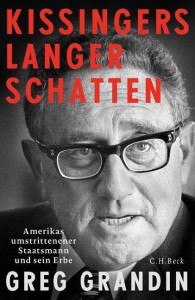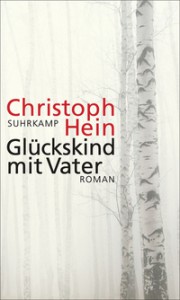38 Gespräche von Carsten Gansel mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zwischen 1989 und 2014 sind im von Norman Ächtler im Verbrecher-Verlag herausgebrachten Band »Literatur im Dialog« chronologisch abgedruckt. Gansel, 1955 in Güstrow geboren und mit dezidiert ostdeutscher Akademikervita, ist seit 1995 Professor für Neuere Deutsche Literatur und Germanistische Literatur- und Mediendidaktik an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die meisten Gespräche aus dem Band wurden in der DDR- Wochenzeitschrift »Sonntag« bzw. später in »Der Deutschunterricht« veröffentlicht; einige sind allerdings erstmalig publiziert. Das 39. Gespräch ist bilanzierend und findet zwischen Carsten Gansel und Norman Ächtler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gießener Institut für Germanistik, statt.
In der interessanten Einleitung Ächtlers, die einige grundsätzliche Fragen behandelt, etwa ob es sich um Interviews oder Gespräche handelt und wie es um die Selbstinszenierungen der Befragten bestellt sein mag, werden die »drei Generationen« vorgestellt, die Gansel in und mit seinen Interviews zu DDR und Literatur befragte: Die Gründungsgeneration nach 1945, die »Heineingeborenen« (ein Wort von Uwe Kolbe) und die heute um die 40jährigen, »Hineingeschriebenen«. Es kommen so unterschiedliche Autoren wie Stefan Heym, Hermann Kant, Christoph Hein, Christa Wolf, Erich Loest, Ulrich Plenzdorf aber auch »westdeutsche« Stimmen wie Peter Kurzeck, Norbert Gstrein, Peter Härtling, Günter Grass oder Alexa Hennig von Lange zum Spannungsfeld von Erinnerung und Literatur und Politik und Publizität (vor allem aber nicht nur im Hinblick auf die »geschlossenen Gesellschaft« der DDR) befragt.
Es gibt mehrere Gründe, warum man dieses Buch nicht mehr so schnell aus der Hand legen mag. So wirken Gansels Sach- und Fachkenntnisse der jeweiligen Publikationen der befragten Autoren auf eine berückende Weise altmodisch. Man ist es vom dröhnenden Feuilleton-Geschwafel einfach nicht mehr gewohnt, dass da jemand tatsächlich die Bücher gelesen hat und kundig (Lektüre-)Eindrücke zu formulieren und einzubringen weiß. Weiterlesen