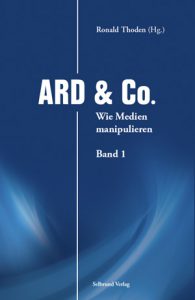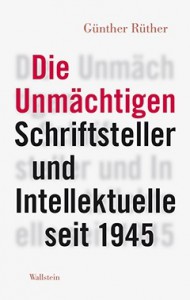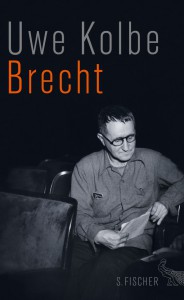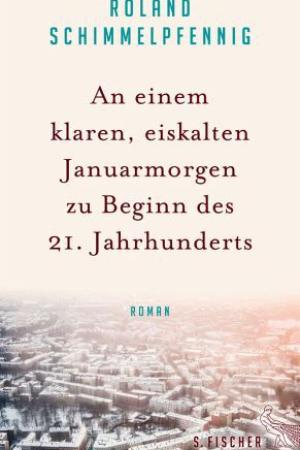
Roland Schimmelpfennig:
An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Ein Wolf überschreitet einen gefrorenen Fluss. Drei Wochen später: Tomasz fährt nach Berlin zu seiner Freundin Agnieszka. Beide kommen aus Polen; er arbeitet auf dem Bau, sie hat mehrere Jobs, als Putzfrau und Kindermädchen, sechs Tage in der Woche. Es schneit und es ist kalt und Tomasz steht in einem Stau, der mehrere Stunden dauern soll. Er steigt aus und da sieht er den Wolf, macht ein Foto und das wird bald ganz Berlin elektrisieren. Fast gleichzeitig verschwindet ein Mädchen, das von seiner Mutter zuweilen geschlagen wird. Sie ist abgehauen mit dem Nachbarsjungen. Der Busfahrer bemerkt das Fehlen. Währenddessen gehen Mädchen und Junge durch den Wald, finden einen toten Jäger mit Gewehr. Der Vater des Jungen ist Alkoholiker, hat kürzlich einen Suizid versucht und ist in der Psychiatrie. Die Eltern des Mädchens sind geschieden; beide waren oder sind Künstler (gewesen). In weiteren Rollen: Charly und Jacky, ein Ehepaar, das in Prenzlauer Berg einen Kiosk betreibt und Dialoge führt wie in einer RTLII-Soap, ein Ex-Lehrer, eine Praktikantin, die über den Wolf für eine Zeitung etwas schreiben soll, ein Chilene, der Rumäne ist, eine Frau, die ihre soeben verstorbene Mutter noch einmal hassen darf und daher deren Tagebücher verbrennt und ein altes Ehepaar.
Es geht um all diese Figuren (und noch ein paar mehr) in Roland Schimmelpfennigs »An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts«. Sie werden in insgesamt 103, meist kurzen szenischen Einspielern, ein paar Tage im Februar 2003 in und um Berlin aus wechselnder Perspektive begleitet. Kern des Buches ist die Ausreißergeschichte zweier Jugendlicher – des »Mädchens« und des »Jungen«. So wie diese beiden bleiben viele andere Figuren in diesem Buch namenlos und wenn die Namen dann doch – mehr oder weniger zufällig – fallen, werden sie nicht verwendet. Da muss der Leser zwischen dem »Vater des Jungen«, »Vater des Mädchens«, »Mutter des Jungen« und »Mutter des Mädchens« unterscheiden. Später kommen unter anderen noch ein Bruder des Vaters des Jungen und eine Freundin der Mutter des Mädchens hinzu. Das klingt verwirrender als es ist. Im Laufe des Buches entsteht dann eine Reigen-Struktur. Es kommt zu kurzen oder, seltener, längeren Begegnungen der Figuren miteinander. Fast jeder bekommt es einmal mit jedem zu tun (sogar das Gewehr macht die Runde) und man könnte sicherlich schöne Graphiken erstellen, wer wem wann begegnet – wenn es nicht so egal wäre. Weiterlesen