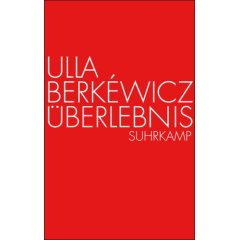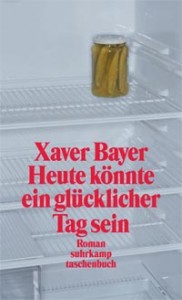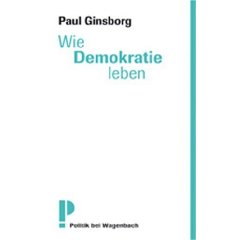
Hier Mill, Entwickler und Verfechter des politischen Liberalismus, der sanfte, eher »sozialdemokratisch« argumentierende Reformer – dort Marx, der schonungslose Beschreiber der Entfremdung des Menschen im Kapitalismus, der wilde Revolutionär, der es leider versäumt habe, seine »Diktatur des Proletariats« ausreichend zu definieren: Kapitel für Kapitel rekurriert Ginsborg immer wieder auf die Thesen dieser beiden Gelehrten und das anfängliche Interesse der Ausarbeitung der Differenzen weicht irgendwann einem Unmut, da ständig aufgezeigt wird, welche zwar für damalige Zeiten bahnbrechende Ideen beide entwickelten, diese jedoch aus heutiger Sicht grosse Schwächen aufweisen. Aber dass aus programmatischen Schriften von vor mehr als 150 Jahren vieles nicht mehr in unsere Gesellschaft »passt« und dem damaligen Zeitgeist geschuldet sein muss – ist das nicht eine allzu triviale Erkenntnis, um sie in dieser Ausführlichkeit auszubreiten?