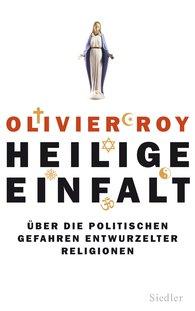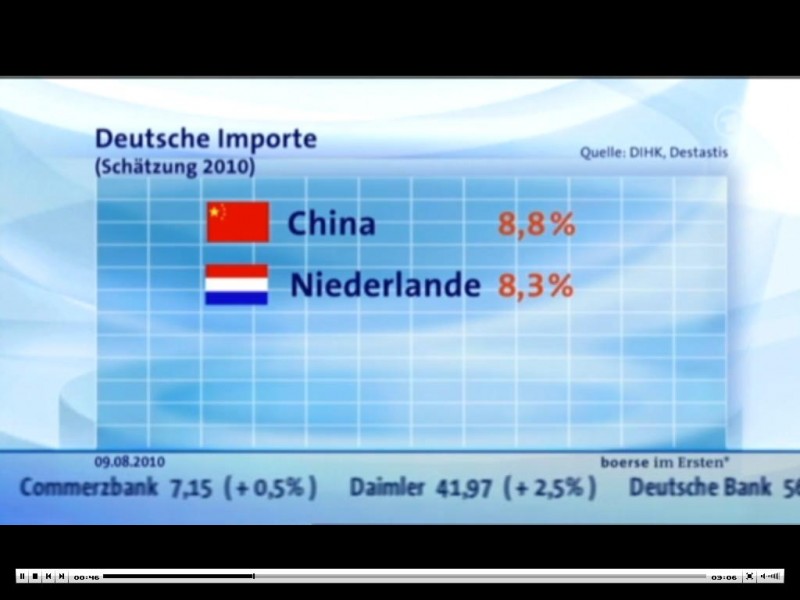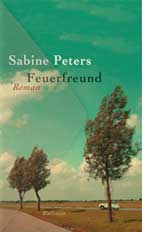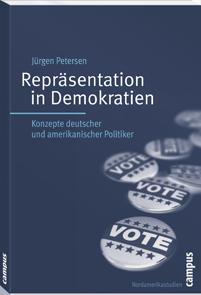Seit vielen Jahren ist Olivier Roy als Experte auf dem Gebiet des islamischen Fanatismus, der gemeinhin unter dem Begriff des Islamismus subsumiert wird, bekannt. Sein neuestes Buch »Heilige Einfalt« (im französischen: »La sainte ignorance«) trägt interessanterweise den deutschen Untertitel »Über die politischen Gefahren entwurzelter Religionen«. Dabei kommt der französische Untertitel weit weniger voreingenommen daher und drückt die Intention des Buches besser aus. Dort heißt es (eher beschreibend): »Le temps de la religion sans culture«, was mit ungefähr »Die Zeit der Religionen ohne Kultur« übersetzt werden kann.
Roy schreibt bereits im ersten Satz, dass seine Ausführungen nicht alleine als Kritik am Islam und dessen (sogenannter) fundamentalistischer Ausprägungen zu lesen sind. Und so wird die Sicht auf das Christentum und den zeitgenössischen Protestantismus, der sich immer mehr zum Evangelikalismus radikalisiert, ausgeweitet. Gelegentlich bezieht Roy sogar das Judentum und den »Hinduismus« in seine Betrachtungen ein. Gleich zu Beginn wird mit einem allzu beliebten Talkshow-Topos aufgeräumt: Es gibt keine »Rückkehr« des Religiösen, sondern eine Veränderung. Wir sind nicht Zeugen einer Explosion der Praxis, sondern eher von neuen Formen der Sichtbarkeit des Religiösen. Das, was wir derzeit beobachten, ist in erster Linie die Auflehnung des Gläubigen, der seinen Glauben bedroht sieht und mit den kulturellen »Herausforderungen« einer säkularen Gesellschaft Probleme hat. Dabei wirkt die Säkularisierung weniger in der Weise, dass sie die Religion an den Rand drängt, sondern indem sie Religion und Kultur voneinander entkoppelt und die Religion autonom werden lässt.
Weiterlesen