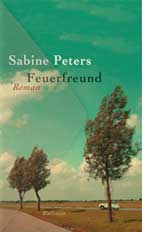Rupert ist ein bekannter Schriftsteller und schreibt Hörspiele. Marie beginnt mit dem Schreiben, veröffentlicht 1990 ihr erstes Buch. Er ist ein politischer Kopf, der mit RAF-Gefangenen korrespondiert und sich als Kommunist bezeichnet. Er hat eine manchmal enervierende Radikalität, schimpft auf den Kleinbürgerdreck anderer (und bei sich selbst) und zieht sich an kleinen Dingen hoch, wie beispielsweise am Trinken von Cola (seiner Frau bringt er sie dann doch vom Kiosk mit). Und wenn er schon einmal einen Weihnachtsbaum kauft, dann muss es eine schiefgewachsene Fichte sein. Irgendwann entsorgt er seine »linken« Bücher; die Bücher über die NS-Zeit hebt er jedoch alle auf. Vergangenheitsbewältigung als ewige Pflicht. Immer wieder Ruperts Zustand, den er Depression nicht nennen mag. Kleine Fluchten: Lesereisen; Portugal. Er braucht die Rückzüge. Mal alleine, mal mit Marie. Ruperts Vorleben, seine Kinder. Und Marie ist eifersüchtig auf diese, seine Vergangenheit. Und ihr Wunsch, mehr Geschichte mit ihm zu teilen.
Am 10. Hochzeitstag ist er 71, sie 38. Sie riecht an dem Leben in ihm heißt es einmal. Glücksmomente: Auch dieser Tag wird mal enden, beschwören sie sich und man weiß nicht genau, ob das Ende immer schon mitgedacht wird. Es ist Liebe und es ist ein Aufschauen, fast Ehrfurcht. Gemeinsames Vorlesen, Teestunden, Quittengelee, »Büchermarkt« im Radio, Ginster ist Unkraut geworden (in Portugal), Nachbarschaftsrituale; Brote und Thermostee bei Ausflügen. Rupert wird nicht heimisch. Es gibt Beziehungsprobleme; Geschichten von Ehebrüchen. Dezente Andeutungen, fast keusch; das ist durchaus angenehm. Sie ziehen nach Hamburg. Unprätentiöser Abschied: …sie klopfen an die kahlen Wände. Als grüßten sie einen Freund. Aber auch Hamburg ist kein idealer Lebens- und Wohnort. Beide retten sich ins Schreiben. Wochenlang Streit; das Streitgedicht. Irgendwann dann Ruperts Krankheit. Diagnose Lungenentzündung. Schließlich Krebs. Der 79. Geburtstag und die Feier mit der Familie. Acht Monate später, August 2008, ist er tot. Bis hierhin wie in einem Film von Margarethe von Trotta.
Eine bohrende, fast kindisch-ungläubige Trauer Maries folgt. Zu Beginn gibt es Briefe an den längst Verstorbenen; genauer: Briefanfänge, die irgendwann abbrechen (der Buchumschlag zeigt eine Briefkuvert-Silhouette). Marie muss sich alleine zurechtfinden. Weiterleben. Aber immer ist Rupert präsent. Die letzten zwei Drittel dieses Buches beschreiben Maries Trauer und die Versuche, diese zu bewältigen. Sie besucht das Rheiderland. Dort ist er begraben. Sie trifft sich mit Ruperts Kindern (die zum Teil ihre Generation sind), tauscht Erinnerungen aus und taucht noch mehr in das Leben dieses, ihren Mannes ein. Beschwörung von Auferstehung. Eine Mischung zwischen gewollter Lustigkeit und Ernst: Rupert liegt immer noch auf dem Friedhof.
Manchmal denkt sie wie er. So geht sie an einer Araukarie vorbei, die sich ihr als eine Mischung aus Krake und Hakenkreuz zeigt und empört sich. Aber der Baum ist nicht verantwortlich für die deutsche Geschichte sagt ihr Gesprächspartner. Stimmt, sagt Marie. Irgendwann wird Ruperts Heiligenschein für den Leser nur noch ärgerlich. Wo ist Marie eigentlich die ganze Zeit? Die Marie, die nicht nur Ehefrau oder Witwe ist?
Auch der oft knappe, fast filmische Erzählstil, der mit einer gewissen Lakonik kokettiert, mag Vorbehalte nicht zu zerstreuen. Es gibt keine Distanz zwischen dem personalen Erzähler, Marie und der Autorin. Man fühlt sich in eine Welt versetzt zwischen Siegfried Lenz, Rosamunde Pilcher und der Gartenlaube. Trauer als Therapie auf Volkshochschulkurs-Niveau. Das Fensterputzen des Hauses als »Ereignis«. Ja, gerne, aber bitte nicht so. Und vollends in den Kitsch treibt es, wenn der neue iPod im Dankgebet der Kollegen eingeschlossen wird oder Marie ein Kleid sieht, welches Rupert gefallen könnte und sie glaubt, er sei bestimmt froh, wenn er sie jetzt so sehen könnte.
Am überzeugendsten sind die Passagen, in denen sie andere über Rupert und ihre Beziehung erzählen lässt. Dann gelingen durchaus schöne Momente, ergreifende Bilder. Aber leider gibt Peters Maries Idiosynkrasien zu häufig nach. Was noch schlimmer ist: Sie scheint es zu merken; Maries Selbstmitleid ist durchaus Thema. Aber ohne Konsequenz. Der Leser kommt sich vor, als müsse er mit einer Hand, die in Honig gegriffen hatte, Zeitung lesen.
Und auch wenn man dieses autobiografische Suchen in der Literatur nicht mag, so wird man hier derart mit der Nase darauf gestoßen, dass man nicht anders kann, als diese herauszuarbeiten. Peters gibt sogar das originale Geburts- und Sterbedatum Ruperts an. Zusätzlich gibt es eine Fülle von weiteren Parallelen zwischen Fiktion und realer Biografie. Danach ist Rupert der 2008 verstorbene Schriftsteller Christian Geissler (den Jürgen Lodemann in seinem Nachruf einen »Hieronymus Bosch des Deutschen Herbstes« nannte). Und daher liegt der Schluss sehr nahe, dass die Autorin wohl Marie ist – auch wenn es natürlich ein fiktionales Werk bleibt. All dies verblüfft, weil Peters wohl eigentlich kein »authentisches« Buch schreiben wollte. (Dazu passt, dass es zur These, Geissler habe seinem Leiden selber ein Ende gesetzt kein Wort in diesem Roman gibt. Warum auch.)
Umso merkwürdiger, als Marie 2009 während ihres dreimonatigen Stipendiums im Künstlerdorf Schöppingen das Googlen und Perlentauchen der Kollegen ob ihrer Person und des Witwentums fürchtet. Drei Klicks, und Ruperts Name könnte auftauchen. Da ist dann doch zu wenig eindeutig, ob die Autorin der Larmoyanz oder eher der Stärke ihrer Protagonistin (also mithin sich selber) Stimme verleihen will. Sollte es das Ziel gewesen sein, die Gefühle von Marie als ein Gemisch zwischen Verzagtheit, Trotz und Lebensmut in ihrer Komplexität und Ambivalenz zu zeigen, ist dies gründlich misslungen. So ist es beispielsweise eine hehre Erkenntnis, dass man die Besuche am Grab eines geliebten Menschen hauptsächlich wegen sich selbst vornimmt. Aber Peters erzählt dies nicht, sondern behauptet es. So gerät »Feuerfreund« (eine Art Kosename für Rupert) zu einer Bekenntnislitanei, die ermüdend ist, weil die Hauptfigur immer wieder in Deklamation verfällt und darin verharrt.
Am Ende legt der Leser das Buch aus der Hand und hat die Personen fast sofort vergessen. Und man trauert dann auch ein wenig. Um so etwas wie eine verpasste Gelegenheit.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.