
Hanns-Josef Ortheil / Klaus Siblewski: Wie Romane entstehen


In Düsseldorf ist Wahlkampf. Nicht, dass das Interesse der Bevölkerung riesig wäre. Schliesslich sind noch Sommerferien und die Oberbürgermeisterwahl erst am 31. August. Nach und nach beginnt man sich vielleicht über die komischen Plakate zu wundern, die Leute zeigen, die man noch nie gesehen hat. Und den Brief mit der Wahlbenachrichtigung hat man erst seit ...
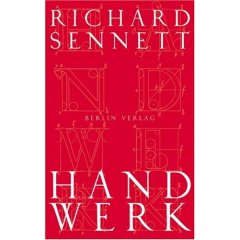
Hephaistos, Schmied und griechischer Gott des Feuers, war nicht nur der Erfinder des Streitwagens, sondern auch Erbauer sämtlicher Häuser auf dem Olymp. Er war der einzige Handwerker unter den griechischen Göttern. Aber Hephaistos ist gezeichnet: Er hat einen Klumpfuss. Und in der antiken griechischen Kultur galten körperliche Missbildungen als Schande. Der Klumpfuss des Hephaistos – symbolisiert er bis heute den gesellschaftlichen Wert des Handwerkers? Zeigt Homers Kapitel über Hephaistos in der »Ilias«, dass die materielle häusliche Kultur den Wunsch nach Ruhm und Ehre niemals zu befriedigen vermag? Und hieraus speist sich – trotz der mittelalterlichen Hochphase der Zünfte (die ausführlich behandelt wird) – auch heute noch das Bild des Handwerkers? Und Pandora, jenes »reizende Mädchen«, die mit ihrer Büchse immer auch als Mahnung für den Zorn der Götter steht, als Gegenpol?
Der entscheidende Satz war wohl dieser:
Deshalb wäge und wähle genau, wer Verantwortung für das Land zu vergeben hat, wem er sie anvertrauen kann – und wem nicht.
Wenige Tage vor der Hessen-Wahl griff Wolfgang Clement in der »Welt« Andrea Ypsilantis Anti-Atompolitik an. Plötzlich gab es mediale Entlastung für Koch, der in einer desaströsen und unverantwortlichen Wahlkampagne alle Aufmerksamkeit auf sich – und gegen sich zog. Aber hat dieser Artikel von Clement wirklich Andrea Ypsilanti den »Sieg« gekostet?
Die ganze Diskussion erinnert mich fatal an das Aufkommen der »Do-It-Yourself«-Bewegung, die in Deutschland irgendwann Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre durchbrach. Kern war ja nicht, dass jemand in seinem Häuschen oder Wohnung kleinere Reparaturen vornahm oder der heute noch teilweise in Dörfern praktizierte »Austausch« von Fertigkeiten untereinander (der Schreiner hilft dem Fliesenleger und vice versa).
Hingabe und engagiertes Tun
Es ging um die Ermöglichung einer Autarkie von dem, was (1.) viel Geld kostete und (2.) dann doch qualitativ hinter dem zurückfiel, was man sich vorstellte. Im Wirtschaftswunderland wurde seinerzeit oft genug handwerklich unzureichend gearbeitet (inzwischen werden die ersten Bauten, in den 60er Jahren hastig errichtet, abgerissen). Handwerker sein hiess damals: Man hatte keine Zeit – und nicht genug Fachkräfte. Der Wohnungs- oder gar Häuslebesitzer war mit dem angebotenen nicht mehr zufrieden. Der Heimwerker wurde erschaffen – anfangs belächelt, später wenn nicht bewundert, dann geachtet. Und wie so oft wurde der Trend vom Fernsehen aufgegriffen – und massenkompatibel gemacht. »Vollendet« wurde diese Entwicklung durch die Baumärkte, die dieses Konzept perfekt umsetzten, in dem sie alle Produkte für den Massenverkauf zur Verfügung stellten.

Im Haus der Gesellschaft bewohnen beide Parteien ihre eigene Etage. Die einen müssen sich mit dem Parterre zufriedengeben, die anderen schielen auf die Beletage. Man ist sich fremd, aber keine der beiden Gruppen kann der anderen bestreiten, dass sie dazugehört. Die Ausgeschlossen…gibt es auf jeder Etage. Sie drücken sich herum, solange es geht, unten vermutlich länger als in der Mitte. […] Es kann aber passieren, dass ein Einzelner aufgrund eines »kritischen Lebensereignisses« ins Strudeln gerät und…vor die Tür gesetzt wird. Nach und nach sammeln sich die Ausgeschlossenen im Flur und wissen nicht mehr, wohin sie gehören.
Mit diesem leicht resignativen Bild bilanziert Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel, seine öffentliche Soziologie »Die Ausgeschlossenen«. Ein Buch, so heisst es im Vorwort, dass nüchtern darstellen will, was Sache ist und explizit nicht nach Vorschlägen sucht. Die Soziologie, so Bude, beweist ihre Stärke immer noch an der Unbekanntheit des sozialen Objekts. (Des Objekts?) Weiter heisst es: Sie erregt Aufmerksamkeit, wenn sie zeigen kann, dass die Dinge anders laufen, als man erwarten würde, und wie es geht, dass es so kommt, wie niemand es will. Nur dann begreife man wirklich, dass das Ganze auch anders sein kann.
Der Naturwissenschaftler Hermann Funk (geboren 1934) verabredet sich im Jahr 2006* mit der Übersetzerin Katharina Fischer. Fischer soll einen englischen Touristen, der sich für die mitteleuropäische
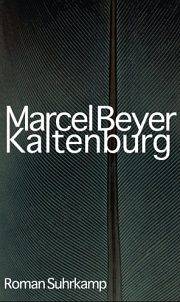
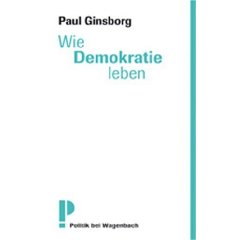
Hier Mill, Entwickler und Verfechter des politischen Liberalismus, der sanfte, eher »sozialdemokratisch« argumentierende Reformer – dort Marx, der schonungslose Beschreiber der Entfremdung des Menschen im Kapitalismus, der wilde Revolutionär, der es leider versäumt habe, seine »Diktatur des Proletariats« ausreichend zu definieren: Kapitel für Kapitel rekurriert Ginsborg immer wieder auf die Thesen dieser beiden Gelehrten und das anfängliche Interesse der Ausarbeitung der Differenzen weicht irgendwann einem Unmut, da ständig aufgezeigt wird, welche zwar für damalige Zeiten bahnbrechende Ideen beide entwickelten, diese jedoch aus heutiger Sicht grosse Schwächen aufweisen. Aber dass aus programmatischen Schriften von vor mehr als 150 Jahren vieles nicht mehr in unsere Gesellschaft »passt« und dem damaligen Zeitgeist geschuldet sein muss – ist das nicht eine allzu triviale Erkenntnis, um sie in dieser Ausführlichkeit auszubreiten?